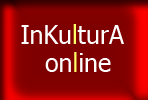Buchkritik -- Michael Angele -- Ein deutscher Platz: Die Ballade vom Stutti
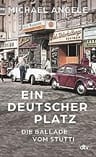 Es gibt Plätze, die sich ihrer Vergangenheit nicht entledigen können, der Stuttgarter Platz gehört zu ihnen. Michael Angele hat ihm eine kleine Denkmalpflege des Gefühls gewidmet, ohne in Sentimentalität zu verfallen. Orte wie dieser erinnern uns daran, dass Geschichte nicht vergeht, sondern sich bloß umzieht. Angele betrachtet den „Stutti“, als lausche er einem alten Freund, der nicht mehr ganz bei Stimme ist, aber noch etwas zu sagen hat – über Verfall, Veränderung und die merkwürdige Zärtlichkeit, die aus beidem entstehen kann.
Es gibt Plätze, die sich ihrer Vergangenheit nicht entledigen können, der Stuttgarter Platz gehört zu ihnen. Michael Angele hat ihm eine kleine Denkmalpflege des Gefühls gewidmet, ohne in Sentimentalität zu verfallen. Orte wie dieser erinnern uns daran, dass Geschichte nicht vergeht, sondern sich bloß umzieht. Angele betrachtet den „Stutti“, als lausche er einem alten Freund, der nicht mehr ganz bei Stimme ist, aber noch etwas zu sagen hat – über Verfall, Veränderung und die merkwürdige Zärtlichkeit, die aus beidem entstehen kann.
Der Stuttgarter Platz in Berlin-Charlottenburg, von den Berlinern liebevoll-berüchtigt „Stutti“ genannt, ist mehr als nur ein Verkehrsknotenpunkt. Er ist ein Brennglas der West-Berliner Geschichte, in dem sich die sozialen und kulturellen Umwälzungen der Nachkriegszeit, des Wirtschaftswunders, der Studentenrevolte und des Wandels der Kieze widerspiegeln.
Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich der im Krieg stark zerstörte Platz zu einem Zentrum des Schwarzhandels. In den Jahren des Mangels, die dem deutschen „Wirtschaftswunder“ vorausgingen, wurde hier alles gehandelt, was überlebenswichtig war. Dieser illegale Markt legte den Grundstein für die spätere Entwicklung des Platzes zu einem Ort am Rande der bürgerlichen Gesellschaft. Während die junge Bundesrepublik in den 1950er und 1960er Jahren einen beispiellosen wirtschaftlichen Aufschwung erlebte, etablierte sich am „Stutti“ eine Parallelwelt. Die Nähe zum Bahnhof Charlottenburg, einem Ankunftsort für viele Reisende, begünstigte die Entstehung einer Infrastruktur aus einfachen Hotels, von denen viele ihre Zimmer stundenweise vermieteten, und Kneipen.
Eine neue, intellektuelle und rebellische Dimension erhielt der Platz 1967, als die „Kommune I“ für einige Monate in eine Altbauwohnung im Eckhaus Stuttgarter Platz/Kaiser-Friedrich-Straße zog. Als politisch motivierte Wohngemeinschaft und Gegenentwurf zur bürgerlichen Kleinfamilie war sie eine der Keimzellen der Studentenbewegung. Mit Mitgliedern wie Rainer Langhans, Fritz Teufel und Dieter Kunzelmann wurde die Kommune durch provokante, satirische Aktionen berühmt, die sich gegen das Establishment und den Vietnamkrieg richteten. Ihr „Pudding-Attentat“ auf den US-Vizepräsidenten Hubert H. Humphrey und ihre Rolle bei den Demonstrationen gegen den Schah-Besuch 1967 machten den Stuttgarter Platz zu einem bundesweit bekannten Symbol der außerparlamentarischen Opposition. Die Kommunarden, die für Interviews und Fotos Geld verlangten („Erst blechen, dann reden!“), zogen Journalisten aus aller Welt an und prägten das Bild des „Stutti“ als Ort der Subkultur und des Protests.
In den 1970er und 1980er Jahren erreichte der Ruf des Stuttgarter Platzes als Rotlichtviertel seinen Höhepunkt. Der als „böser Stutti“ bekannte Bereich zwischen Krumme Straße und Windscheidstraße war geprägt von Prostitution, Kriminalität und Gewalt. Raub, Schlägereien und Messerstechereien gehörten zur Tagesordnung. Kiez-Größen wie Bernd Termer kontrollierten ein Imperium aus Bordellen und Bars. Für viele Anwohner war der Platz eine No-go-Area; Großmütter verboten ihren Enkelinnen, den „Stutti“ zu überqueren.
Ab den späten 1970er Jahren formierte sich Widerstand in der Anwohnerschaft. Eine 1978 gegründete Bürgerinitiative setzte sich erfolgreich für eine Verkehrsberuhigung und die Anlage einer Grünfläche ein. Diese Aufwertung des Wohnumfeldes leitete einen langsamen Wandel ein. Sozial schwächere Bewohner wurden verdrängt, und nach und nach siedelten sich neue, schickere Geschäfte und Cafés an. Das Rotlichtmilieu begann zu schwinden, beschleunigt durch den Wegfall der Geschäftsgrundlage für die zahlreichen „Import-Export-Läden“ nach dem EU-Beitritt Polens. Heute ist von dem einst berüchtigten Milieu kaum mehr etwas übrig. Eine Gedenktafel, die 2019 angebracht wurde, erinnert an die Zeit der Kommune I, während gehobene Bars und Feinkostläden das Bild des Platzes neu definieren und seine bewegte Vergangenheit in den Hintergrund rücken lassen.
Eine Schönheit ist der Stuttgarter Platz längst nicht mehr; das, was einst mondän hieß, trägt heute die Spuren der Jahre, in denen die Welt zu schnell wurde für solche Orte. Seit 1989, als sich nicht nur Grenzen, sondern auch Gewissheiten öffneten, hat er vieles verloren: an Glanz, an Haltung, vielleicht auch an Geduld. Und doch, folgt man Michael Angele durch seine Geschichten vom Leben auf und um den Platz, kann es geschehen, dass man ihn plötzlich wieder mag – nicht trotz, sondern wegen seiner Risse. Weil hier noch etwas Menschliches übrig blieb, das sich dem großen Vergessen widersetzt.
Meine Bewertung:
Veröffentlicht am 3. Oktober 2025