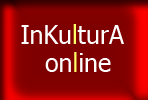Buchkritik -- T.C. Boyle -- No Way Home
 T.C. Boyle hat wieder ein Terrarium der Menschlichkeit eingerichtet. „No Way Home“ spielt nicht einfach in der Wüste Nevadas, sondern in jener seelischen Ödnis, die man einst das „amerikanische Herzland“ nannte, und heute mit einem leerstehenden Walmart verwechselt. Hier leben drei Menschen, Terry, Bethany und Jesse,, die das Stillstehen mit Leben verwechseln.
T.C. Boyle hat wieder ein Terrarium der Menschlichkeit eingerichtet. „No Way Home“ spielt nicht einfach in der Wüste Nevadas, sondern in jener seelischen Ödnis, die man einst das „amerikanische Herzland“ nannte, und heute mit einem leerstehenden Walmart verwechselt. Hier leben drei Menschen, Terry, Bethany und Jesse,, die das Stillstehen mit Leben verwechseln.
Terry, der Arzt, tastet sich mit der Präzision eines Röntgengeräts durchs Dasein. Er erkennt Symptome, aber keine Ursachen, und schon gar keine, die in ihm selbst liegen. Sein Beruf ist sein Alibi. Er behandelt Krankheiten, nicht Menschen, und am wenigsten sich selbst. In einem Land, das Effizienz mit Moral verwechselt, verkörpert Terry den letzten Stand der amerikanischen Seele: klinisch rein, aber existenziell unversichert.
Bethany, seine ungebetene Mitbewohnerin, wirkt dagegen wie die verzweifelte Allegorie auf ein Land, das vom „Traum“ lebt, und längst in der Schlafparalyse seiner selbst liegt. Sie konsumiert Gefühle, Männer, Gelegenheiten, alles, was kurzzeitig Glanz verspricht. Sie zieht in Terrys Haus ein, als ziehe sie in die amerikanische Idee vom Glück: unvorbereitet, besitzergreifend, ohne zu merken, dass es längst nicht mehr ihre ist.
Und Jesse, der trunkene Lehrer mit Autorenphantasien, steht als grotesker Restposten intellektueller Männlichkeit. Er will ein Buch schreiben, um zu beweisen, dass er existiert, ein sympathisches Missverständnis in einem Land, das das Erzählen längst dem Streaming überlassen hat. Sein Alkohol ist kein Laster, sondern die letzte Form des Pathos. Er trinkt, damit wenigstens etwas brennt.
Boyles Erzählung ist eine Chronik der Bewegungslosigkeit, eine Parabel über ein Amerika, das noch überall hinfährt, aber längst nirgends mehr ankommt, weil die Richtung abgeschafft wurde. Die drei Protagonisten agieren, als habe jemand die „Selbstverwirklichung“ in die Endlosschleife gestellt: Terry funktioniert, Bethany inszeniert, Jesse implodiert. Und das alles in einem Land, das sich selbst für den Schauplatz hält.
Das Haus in der Wüste, Terrys Erbe, ist das perfekte Symbol dieser Befindlichkeit: ein Besitz ohne Bedeutung, eine Immobilie im doppelten Sinn. Hierher führt kein Weg, und hinaus schon gar keiner. Selbst der Hund der verstorbenen Mutter wirkt wie das letzte Lebewesen mit Instinkt.
Boyle, der alte Zyniker mit Herz, seziert seine Figuren mit der Gelassenheit eines Mannes, der weiß, dass die Menschheit sich selbst längst zu Studienzwecken ausstellt. Seine Ironie ist nicht spöttisch, sondern archäologisch: Er gräbt im Sand nach Resten von Sinn und findet nur Bewusstseinsfragmente, Kreditkarten, leere Flaschen, Selbstdiagnosen.
Dass die Handlung plätschert, ist kein Mangel, sondern Methode. Dieses Buch erzählt keine Geschichte, sondern einen Zustand. Es beschreibt das Amerika nach der Sinnexplosion und dem Scheitern der Idee vom Ich. In „No Way Home“ agieren drei Menschen und warten, dass etwas geschieht, aber sie sind zu sehr sie selbst, als dass es passieren könnte.
Am Ende bleibt die bittere Pointe: Das „home“, das keiner findet, ist nicht geografisch, sondern seelisch. Es ist das verlorene Zentrum des Bewusstseins, die Fähigkeit, in sich selbst eine Richtung zu erkennen. Terry, Bethany und Jesse haben sie aufgegeben. Und Boyle, mit seinem unverwechselbar lakonischen Lächeln, schreibt auf die Titelseite: „Willkommen daheim, Sie sind schon da.‟
Drei Amerikaner im seelischen Off, und Boyle beobachtet sie, als wären wir es selbst. Unbedingt lesen.
Meine Bewertung:
Veröffentlicht am 1. November 2ß25