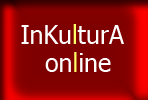Buchkritik -- John Boyne -- Die Elemente
 Es gibt Romane, die sich nicht lesen lassen, ohne dass man gleichzeitig selbst gelesen wird – von den Figuren, von ihren Abgründen, von den Fragen, die man so sorgfältig verdrängt hat, bis ein Satz oder eine Geste sie wieder hervorholt wie etwas, das man am liebsten im Geröll der eigenen Vergangenheit vergraben hätte. John Boynes vierteiliger Zyklus „Die Elemente‟ gehört zu jener seltenen Gattung erzählerischer Unternehmungen, die nicht darauf aus sind, ihre Leser zu unterhalten, sondern sie zu prüfen.
Es gibt Romane, die sich nicht lesen lassen, ohne dass man gleichzeitig selbst gelesen wird – von den Figuren, von ihren Abgründen, von den Fragen, die man so sorgfältig verdrängt hat, bis ein Satz oder eine Geste sie wieder hervorholt wie etwas, das man am liebsten im Geröll der eigenen Vergangenheit vergraben hätte. John Boynes vierteiliger Zyklus „Die Elemente‟ gehört zu jener seltenen Gattung erzählerischer Unternehmungen, die nicht darauf aus sind, ihre Leser zu unterhalten, sondern sie zu prüfen.
Was als literarische Antwort auf die Zumutungen zeitgenössischer True-Crime-Ästhetik beginnt, jene bleiern grinsende Indifferenz, mit der Streamingdienste Täter zu popkulturellen Marken und Opfer zu Statisten degradieren, wächst sich bei Boyne zu einer poetischen Archäologie menschlicher Verletzbarkeit aus. In der Landschaft der zeitgenössischen Literatur legt der irische Autor ein Opus von epischen Ausmaßen und erschütternder Tiefe vor. Seine Figuren sind keine Fallbeispiele, sie sind keine Gesprächsobjekte, sie sind die beunruhigenden Spiegelungen jener Grauzonen, die niemand gern betritt.
Boyne ordnet diese Welt der Verwundungen nach den Grundstoffen, aus denen auch Mythen gemacht sind: Erde, Luft, Wasser, Feuer. Schon die Kargheit dieser Struktur verrät eine Ambition, die weit über kriminalistische Motive hinausreicht. Es geht um die elementare Frage: Was bleibt vom Menschen übrig, wenn man ihm jene moralische Deckgeschichte entreißt, die er sich selbst erzählt hat? Auf über fünfhundert Seiten entfaltet sich ein erzählerisches Panorama, das die Schicksale von vier zentralen Figuren verfolgt, die jeweils eine archetypische Rolle im unheilvollen Kreislauf von Gewalt und Missbrauch verkörpern: die stille Ermöglicherin, der schuldhafte Komplize, die zur Täterin gewordene einstige Opfer und das um Erlösung ringende Opfer.
Vanessa Carvin, die im Exil auf einer windzerzausten Insel vor Irland einen neuen Namen annimmt wie ein notdürftiges Alibi vor sich selbst, formuliert den Kernsatz dieses Zyklus: „Keiner von uns ist unschuldig und keiner schuldig." Es ist ein Satz, den nur jemand ausspricht, der gelernt hat, dass der Schmerz keine eindeutigen Urheber kennt. Nicht Boyne relativiert Schuld, sondern seine Figuren werden darin verstrickt, gleichsam in eine tektonische Verschiebung ihrer eigenen Lebensgeschichte. Vanessa, einst Opfer, später Mitwisserin; Evan, der gefeierte Fußballstar, den der Ruhm nicht schützt; Freya, die Ärztin, die Brandopfer behandelt und zugleich selbst verkohlt in den Erinnerungen an eine Kindheit, die nie heilt; Aaron, der Therapeut, der glaubt, das Innenleben anderer zu ordnen, während sein eigenes im Untergrund bebt – sie alle tragen die Ambivalenz der Täter-Opfer-Schleife in sich wie ein unsichtbares Brandmal.
Die erzählerische Souveränität, mit der Boyne dieses schwere Sujet meistert, ist schlichtweg meisterhaft. Seine Prosa ist von einer kristallinen Klarheit und zugleich von einer Sogwirkung, die auch angesichts der schrecklichen Ereignisse eine fast thrillerartige Spannung erzeugt. Er bettet seine Figuren in ein Netz subtiler Überkreuzungen ein, in dem eine als Schatten im Prozess des anderen auftaucht und ein beiläufiger Satz sich als stiller Kommentar zum gesamten moralischen Inventar des Romans entpuppt. Besonders bemerkenswert ist dabei die konsequente Einnahme der Opferperspektive, die einen notwendigen Kontrapunkt zur oft voyeuristischen Täter-Fokussierung setzt. Gewiss, die Zuordnung der vier Bereiche wirkt mitunter künstlich, beinahe schulmeisterlich. Wenn Freya beim Bier über die zerstörerische Kraft der Luft doziert, fühlt man den erzählerischen Zwang, der dieser Architektur eingeschrieben ist. Die schiere Häufung von schicksalhaften Zufällen strapaziert gelegentlich die Glaubwürdigkeit. Doch gerade darin liegt ein Reiz: Die Elemente fungieren weniger als thematische Etiketten denn als tektonische Schichten, mal verschoben, mal übereinander gedrückt, mal löchrig wie vulkanisches Gestein. Erde ist der Ort der Erstarrung, Luft der Ort des Ausgeliefertseins, Wasser das Medium des Versinkens, Feuer der Moment der Unwiderruflichkeit. Boyne ist weniger an Kategorien interessiert als an Verwerfungen.
Wo andere Romane sich damit begnügen würden, individuelle Schicksale auszuleuchten, zwingt Boyne seine Leser, die Kontroversen der Gegenwart mitzudenken: den Sexismus in Strafprozessen, die inquisitorische Lust am Opfervergleich, die gefährliche Verkürzung komplizierter Biografien auf den einen Augenblick des moralischen Versagens. Freya und Rebecca, die Tochter Vanessas, verhandeln in einem offenen Schlagabtausch die zentrale Frage unserer Epoche: Ist Gewalt ein Erbe oder eine Entscheidung? Die eine pocht auf Verstehbarkeit, die andere fordert Verantwortung, und beide haben Recht, was die Diskussion nur schmerzhafter macht. Boyne lässt uns an keiner Stelle aus dieser Unentschiedenheit entkommen.
Am Ende bleiben wir mit einer der eindrücklichsten Gestalten dieses Romans zurück: einem Mann, der zwanzig Jahre lang versucht hat, die innere Landschaft seiner Vergangenheit wieder bewohnbar zu machen. Seine Stimme ist leise, aber sie trägt den Klang einer Verletzung, die nicht dramatisch explodiert, sondern langsam in den Alltag sickert. „Ich bin noch nicht so weit", sagt er. „Aber eines Tages werde ich es sein." Man möchte ihm glauben, doch Boyne lässt offen, ob dieser Tag je kommen wird. Heilung ist hier kein Ziel, sondern eine Richtung. John Boynes epischer Romanzyklus ist nichts weniger als die Anatomie des moralischen Erdbebens.
Und dann bleibt noch jene herrlich lakonische Frage nach der Publikationshistorie, die als Nachhall über der ganzen Lektüre liegt: Zunächst in vier Einzelbänden herausgegeben und zwischen 2023 und 2025 mit »Water«, »Earth«, »Fire« und »Air« als separate Novellen im Vereinigten Königreich und Irland erschienen, ehe sie im September 2025 in den USA (bei Henry Holt) und UK (bei Doubleday) als Gesamtausgabe unter dem Titel »The Elements« vereint wurden, um jetzt vom Piper Verlag wieder sapariert herausgegeben zu werden.
Vielleicht gehört gerade diese Zerteilung paradox ins Programm: Ein Roman über verletzte, zerbrochene, fragmentierte Existenzen erscheint in vier Teilen – ein eleganter Treppenwitz des Literaturbetriebs.
Meine Bewertung:
Veröffentlicht am 21. November 2025