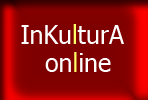Buchkritik -- James Lee Burke -- Clete
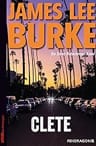 James Lee Burke gilt seit Jahrzehnten als Chronist des amerikanischen Südens, ein Erzähler, der aus der Schwüle von Louisiana, aus Armut, Korruption und Gewalt poetische Bilder von seltener Intensität gewinnt. Seine Helden, allen voran Dave Robicheaux und Clete Purcel, waren stets verletzliche Männer, gebrochen von Krieg, Alkohol und moralischen Zweifeln, zugleich aber geerdet in der realistischen Topografie der Südstaaten.
James Lee Burke gilt seit Jahrzehnten als Chronist des amerikanischen Südens, ein Erzähler, der aus der Schwüle von Louisiana, aus Armut, Korruption und Gewalt poetische Bilder von seltener Intensität gewinnt. Seine Helden, allen voran Dave Robicheaux und Clete Purcel, waren stets verletzliche Männer, gebrochen von Krieg, Alkohol und moralischen Zweifeln, zugleich aber geerdet in der realistischen Topografie der Südstaaten.
Mit „Clete‟, dem 24. Band um die beiden Freunde und Kämpfer für das Gute, verlässt Burke leider diesen vertrauten Boden und betritt ein Terrain, das seine Leser spalten dürfte. Statt wie gewohnt eines Kriminalromans mit sozialkritischem Tiefgang entfaltet sich eine geradezu mystische Südstaaten-Epopöe. Johanna von Orléans erscheint, Heiligenvisionen durchwehen die Handlung, und Clete Purcel, einst eine Figur zwischen Gut und Böse, wird plötzlich zur Märtyrerfigur stilisiert , ein Ritter im Kampf gegen dunkle Mächte, die längst nicht mehr bloß in Gestalt korrupter Politiker oder brutaler Gangster auftreten, sondern als metaphysische Entität.
Gerade an den Frauenfiguren zeigt sich, wie stark Burke den Boden des Realismus verlässt. Chen, die drogensüchtige junge Frau, hätte als Spiegel von Cletes eigener Verlorenheit wirken können , als lebendige Mahnung an dessen Abhängigkeit, seine nie ganz besiegte Sucht und das fragile Verhältnis zwischen Selbstzerstörung und Überleben. Stattdessen bleibt sie eine Randnotiz, die im Verlauf der Handlung verschwindet.
Gracie, einst Polizistin, eröffnet für einen Moment die Möglichkeit, eine ambivalente, vielschichtige weibliche Figur in den Vordergrund zu stellen , eine, die das Spannungsfeld von Gesetz und Gesetzlosigkeit in sich trägt. Doch auch sie verflüchtigt sich, als würde Burke die eigene Andeutung nicht weiter ausführen wollen.
Schließlich Clara Bow, die Ehefrau des skrupellosen reichen Mannes: ein klassisches Motiv von Befreiung, Emanzipation, Widerstand gegen männliche Macht. In einem der Vorgängerromane wäre sie wohl zu einer stillen moralischen Instanz geworden. Hier hingegen gleitet sie aus der Handlung wie ein Schatten, dem keine Konturen verliehen werden.
So verlieren diese drei Figuren ihr erzählerisches Gewicht, und damit verliert der Roman jene Balance, die Burke einst auszeichnete: das Gleichgewicht zwischen harter Realität und poetischer Überhöhung. Statt der Stimmen verletzlicher Frauen, die den Roman hätten erden können, hallen die Chöre der Mystik.
Diese Überhöhung ist zweischneidig. Einerseits verleiht sie der Geschichte eine sakrale Dimension, eine Wucht, die man so in der Kriminalliteratur nicht findet. Andererseits entfremdet sie genau jene Leser, die Burke bislang für seine sprachliche Erdgebundenheit und die realistische Darstellung seiner Figuren verehrten. Wo früher die Ambivalenz des Menschen im Vordergrund stand, dominiert nun das Pathos einer Heilsbotschaft.
So liest sich „Clete‟ weniger als Thriller denn als Vermächtnis eines Autors, der in seinem Spätwerk nicht mehr die Logik der Handlung, sondern die moralische und spirituelle Überhöhung sucht. Burke schreibt mit diesem Werk, so hat es den Anschein, nicht mehr bloß Romane, sondern er predigt, beschwört und stilisiert. Man mag das als Alterswerk respektieren, als letzten Versuch, dem eigenen Œuvre einen metaphysischen Rahmen zu geben. Doch man darf auch feststellen: Der Preis dafür ist die Aufgabe jener literarischen Balance, die Burke einst zu einem Meister des modernen Südstaaten-Noir machte.
Meine Bewertung:
Veröffentlicht am 15. September 2025