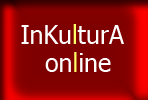Buchkritik -- Harald Nagl -- Krieg gegen Russland
 Es gehört zur Ironie unserer Gegenwart, dass wir, während die Bilder aus Kiew, Charkiw oder Mariupol längst ins Archiv der Dauerberieselung wanderten, ein Buch wie Harald Nagls „Krieg gegen Russland“ aufschlagen müssen, um noch einmal zu begreifen, was eigentlich geschah. Die Tagesmeldungen, im Sekundentakt konsumiert und im nächsten Augenblick schon vergessen, haben den Blick für die Tektonik des Konflikts verstellt. Nagl hingegen zwingt uns, langsamer zu lesen, und gerade dadurch klarer zu sehen.
Es gehört zur Ironie unserer Gegenwart, dass wir, während die Bilder aus Kiew, Charkiw oder Mariupol längst ins Archiv der Dauerberieselung wanderten, ein Buch wie Harald Nagls „Krieg gegen Russland“ aufschlagen müssen, um noch einmal zu begreifen, was eigentlich geschah. Die Tagesmeldungen, im Sekundentakt konsumiert und im nächsten Augenblick schon vergessen, haben den Blick für die Tektonik des Konflikts verstellt. Nagl hingegen zwingt uns, langsamer zu lesen, und gerade dadurch klarer zu sehen.
Das Buch beginnt nicht, wie man erwarten könnte, mit einer bloßen Chronik der Schlachten, Offensiven und Rückzüge. Nagl interessiert sich weniger für die operative Feinmechanik der Frontlinien als vielmehr für das, was in den Schatten jener Linien liegt: die langen historischen Linien, die uns von den letzten Tagen der Sowjetunion über die naive Euphorie der 1990er-Jahre in die kalte Ernüchterung des Jahres 2022 führen. Er schildert die russische Invasion vom 24. Februar 2022 nicht als isolierten Schock, sondern als Kulminationspunkt einer Entwicklung, die allzu viele in Europa wie auch in Washington verdrängten oder kleinredeten.
Dabei arbeitet Nagl mit einem Handwerkszeug, das sowohl politikwissenschaftlich präzise als auch essayistisch durchdrungen ist. Er denkt Geschichte in Schichten, nicht in Momenten. In seinen Ausführungen zum Euromaidan und zur Annexion der Krim, zu den halbherzigen Waffenstillständen und dem zähen Ringen um Minsk II, erkennt man die Handschrift eines Autors, der den Konflikt nicht auf die Tagespolitik reduziert, sondern als Ausdruck einer umfassenden Neuordnung begreift. „Krieg gegen Russland“ ist somit weniger eine Chronik als eine Kartographie; ein Versuch, die unsichtbaren Kräfte zu verzeichnen, die das Weltgeschehen verschoben haben und noch verschieben werden.
Besonders hervorstechend ist Nagls schonungslose Analyse westlicher Politik. Er verwehrt sich dem bequemen Narrativ einer völlig überraschend über die Welt hereinbrechenden geopolitischen Katastrophe. Stattdessen betont er, dass der Krieg in der Ukraine nur vor dem Hintergrund einer langjährigen amerikanischen Weltpolitik zu verstehen sei, die seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion darauf abzielte, Einflusszonen zu erweitern und geopolitische Räume neu zu strukturieren.
Damit begibt sich Nagl bewusst in ein intellektuelles Minenfeld. Denn wer den Westen nicht allein als Opfer russischer Aggression, sondern zugleich als Mitspieler benennt, riskiert, in den Verdacht einer Relativierung zu geraten. Doch Nagl gelingt es, diesen Verdacht durch eine nüchterne Diktion zu entkräften. Er stilisiert nicht, er verteidigt nicht, er verklärt nicht, er beschreibt. Sein Blick auf die NATO-Osterweiterung oder die amerikanische Globalstrategie vermeidet die Schärfe der Anklage, ohne die Klarheit der Diagnose zu verlieren.
Ein zentraler Aspekt, den Nagl in seiner Analyse hervorhebt, ist der fundamentale Gegensatz zwischen der idealistischen, wertebasierten Außenpolitik des Westens und Putins kompromisslos realistischer Machtpolitik. Dieser theoretische Konflikt zwischen zwei grundlegend verschiedenen Weltanschauungen bildet das konzeptionelle Rückgrat der heutigen geopolitischen Spannungen und erklärt, warum Dialog und Verständigung zwischen den Blöcken so schwierig geworden sind.
Die westliche Außenpolitik der letzten Jahrzehnte war geprägt von einem tiefen Glauben an die Universalität demokratischer Werte und die Möglichkeit, durch militärische Interventionen und politischen Druck autoritäre Regime zu stürzen und demokratische Strukturen zu etablieren. Diese idealistische Herangehensweise basierte auf der Überzeugung, dass alle Menschen nach Freiheit, Demokratie und Menschenrechten streben und dass es die moralische Pflicht des Westens sei, diese Werte zu verbreiten. Die Interventionen in Afghanistan, Irak, Libyen und die Unterstützung des Arabischen Frühlings waren Ausdruck dieser wertebasierten Politik, die davon ausging, dass der Sturz autoritärer Herrscher automatisch zu stabilen, demokratischen Gesellschaften führen würde.
Das Scheitern dieser Interventionen war jedoch spektakulär und nachhaltig. Afghanistan, nach zwanzig Jahren westlicher Präsenz und Billionen von Dollar an Investitionen, fiel binnen weniger Tage wieder an die Taliban zurück. Der Irak versank nach dem Sturz Saddam Husseins in einem jahrelangen Bürgerkrieg, der das Land destabilisierte und den Aufstieg des Islamischen Staates ermöglichte. Libyen, einst das wohlhabendste Land Afrikas, wurde nach der NATO-Intervention 2011 zum gescheiterten Staat, geplagt von Bürgerkrieg, Terrorismus und Menschenhandel. Syrien erlebte einen der brutalsten Konflikte des 21. Jahrhunderts, bei dem Hunderttausende starben und Millionen zu Flüchtlingen wurden.
Der Arabische Frühling, der zunächst als Triumph der demokratischen Ideale gefeiert wurde, endete in den meisten Ländern in Chaos, Bürgerkrieg oder der Rückkehr autoritärer Strukturen. Ägypten erlebte nach dem Sturz Mubaraks eine kurze demokratische Phase, bevor das Militär unter General al-Sisi wieder die Macht übernahm. Tunesien, das einzige Land, das zunächst als Erfolgsgeschichte galt, rutschte ebenfalls in die Autokratie ab. Diese Fehlschläge offenbarten die Grenzen einer Politik, die komplexe gesellschaftliche, kulturelle und historische Realitäten ignorierte und naive Annahmen über die Übertragbarkeit westlicher Institutionen machte.
Putin und die russische Führung beobachteten diese Entwicklungen mit einer Mischung aus Schadenfreude und Bestätigung ihrer eigenen Weltanschauung. Aus russischer Sicht bestätigten die westlichen Fehlschläge die Überlegenheit einer realistischen Außenpolitik, die auf Machtbalance, Einflusssphären und der Anerkennung geopolitischer Realitäten basiert. Putin sieht die Welt nicht durch die Brille universeller Werte, sondern als ein anarchisches System souveräner Staaten, in dem jeder für seine eigenen Interessen kämpft. Für ihn sind westliche Werte wie Demokratie und Menschenrechte nicht universelle Prinzipien, sondern Instrumente der amerikanischen Hegemonie, die dazu dienen, andere Länder zu schwächen und zu kontrollieren.
Hier liegt die intellektuelle Stärke des Buches: Es ruft nicht zur Parteinahme auf, sondern zum Verständnis. Dieses Verständnis ist unbequem, weil es den Leser zwingt, die bequeme Einteilung in „Aggressor“ und „Verteidiger“ durch eine komplexere Topographie zu ersetzen. Russland bleibt der Invasor, daran besteht kein Zweifel, doch die geopolitische Bühne, auf der es seine Panzer rollen ließ, wurde nicht von Moskau allein errichtet.
Nagl spart nicht mit Analysen zur militärischen und sozialen Lage in der Ukraine selbst. Er beschreibt, wie aus dem vermeintlich kurzen, entscheidenden Waffengang ein zermürbender Abnutzungskrieg wurde. Die Ukraine, anfangs getragen von einem schier unerschütterlichen Verteidigungswillen und vom mächtigen Rückhalt des Westens, sieht sich zunehmend mit der Realität strategischer Erschöpfung konfrontiert. Je länger der Krieg dauert, desto deutlicher wird, dass auch unbegrenzte Waffenlieferungen und Solidaritätsadressen nicht zwangsläufig in eine Wiederherstellung der territorialen Integrität münden.
Dabei verzichtet Nagl auf dramatische Rhetorik. Seine Sprache bleibt sachlich, beinahe nüchtern, und gerade deshalb von beklemmender Wirkung. Er verweilt nicht bei den heroischen Gesten der ersten Monate, sondern richtet den Blick auf den Alltag des Krieges: auf die Verschiebung gesellschaftlicher Strukturen, auf die permanente Mobilmachung, auf die Frage, wie ein Land, das seit Jahren im Ausnahmezustand lebt, überhaupt wieder in eine „Normalität“ zurückfinden könnte.
Ein weiterer Strang des Buches widmet sich den diskursiven und moralischen Dimensionen des Krieges. Nagl analysiert, wie Propaganda auf beiden Seiten zur Waffe wird, im Westen in Form einer oft simplifizierenden Medienberichterstattung, in Russland als staatlich orchestrierte Parallelrealität. Zugleich erinnert er an das Leiden der Zivilbevölkerung, an Kriegsverbrechen und an das, was im Rauschen geopolitischer Analysen oft verloren geht: den Menschen, der auf der Flucht ist, der Angehörige verliert, der sich in einem zerstörten Haus wiederfindet.
Doch auch hier bleibt der Autor dem Gestus der Überhöhung fern. Er verzichtet auf Pathos, und gerade diese Zurückhaltung macht seine Schilderungen eindringlich. Nagl weiß, dass ein Zuviel an moralischer Empörung die moralische Substanz oft entwertet.
Das eigentliche Ziel des Buches ist jedoch nicht die Analyse des Krieges allein, sondern der Blick darüber hinaus. Nagl skizziert die Umrisse einer neuen Weltordnung, in der die Ukraine nur noch Symptom ist, nicht Ursache. Er erkennt in der Konfrontation zwischen Russland und dem Westen einen paradigmatischen Konflikt: den Übergang von einer unipolaren Welt unter amerikanischer Dominanz zu einer multipolaren Ordnung, in der China, Indien oder auch regionale Mächte ein neues Gewicht beanspruchen.
In dieser Diagnose liegt die wohl provokanteste These des Autors. Denn sie relativiert nicht den Krieg selbst, wohl aber seine Position im globalen Machtgefüge. Der Ukrainekrieg wird damit zur Chiffre einer viel umfassenderen Verschiebung, die uns, so Nagls Befund, noch über Jahrzehnte beschäftigen wird.
Harald Nagl gelingt es in seinem Werk, diese komplexen Zusammenhänge in einen kohärenten Rahmen zu bringen. Seine Analyse zeichnet sich durch eine bemerkenswerte Ausgewogenheit aus, die weder in unkritische Apologetik noch in pauschale Verurteilung verfällt. Stattdessen bemüht er sich um ein Verständnis der verschiedenen Perspektiven und Motivationen, die zu dem aktuellen Konflikt geführt haben. Besonders hervorzuheben ist seine Fähigkeit, die historischen Wurzeln der heutigen Spannungen aufzuzeigen und dabei sowohl die russische als auch die westliche Sichtweise zu berücksichtigen.
Der Autor macht deutlich, dass der Krieg in der Ukraine nicht als isoliertes Ereignis betrachtet werden kann, sondern als Kulminationspunkt einer jahrzehntelangen Entwicklung, die ihre Wurzeln in den chaotischen 1990er Jahren, der NATO-Osterweiterung und den zunehmend autoritären Tendenzen in Russland hat. Dabei vermeidet er es, einfache Antworten auf komplexe Fragen zu geben, und zeigt stattdessen die Vielschichtigkeit der Problematik auf.
Nagls Werk ist somit nicht nur eine Analyse des aktuellen Konflikts, sondern auch ein wichtiger Beitrag zum Verständnis der geopolitischen Dynamiken des 21. Jahrhunderts. Es verdeutlicht, wie historische Erfahrungen, nationale Mythen und geopolitische Ambitionen zusammenwirken können, um zu einer Eskalation zu führen, die für alle Beteiligten verheerende Folgen hat. In einer Zeit, in der schnelle Urteile und einfache Erklärungen dominieren, bietet Nagls differenzierte Betrachtung eine wertvolle Orientierungshilfe für alle, die die Hintergründe des Ukraine-Konflikts verstehen wollen.
Meine Bewertung:
Veröffentlicht am 1. September 2025