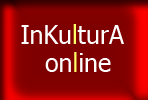Buchkritik -- Jonathan Coe -- Der Beweis meiner Unschuld
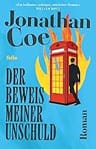 Jeder, der in den letzten Jahren in Großbritannien mit dem Zug gereist ist, dürfte die allgegenwärtige Durchsage „See it, Say it, Sort it“ – jenes stoische Mantra der britischen Verkehrspolizei, das Reisende mahnt, jegliches verdächtige Verhalten zu melden – längst überdrüssig geworden sein. Diese sterile Aufforderung zur Wachsamkeit, die das Gefühl unbeschwerter Bewegung durch einen Hauch von Misstrauen ersetzt, bildet den Ausgangspunkt von Jonathan Coes neuestem Roman „Der Beweis meiner Unschuld“. Der Autor, den man ohne Übertreibung den „britischsten“ aller zeitgenössischen britischen Schriftsteller nennen darf, kanalisiert darin jenes unterschwellige Unbehagen, das den öffentlichen Raum längst in eine Bühne gegenseitiger Kontrolle verwandelt hat und verwandelt es in eine bitter-komische Reflexion über die Kultur seines Landes und die Sinnfrage des literarischen Schreibens selbst.
Jeder, der in den letzten Jahren in Großbritannien mit dem Zug gereist ist, dürfte die allgegenwärtige Durchsage „See it, Say it, Sort it“ – jenes stoische Mantra der britischen Verkehrspolizei, das Reisende mahnt, jegliches verdächtige Verhalten zu melden – längst überdrüssig geworden sein. Diese sterile Aufforderung zur Wachsamkeit, die das Gefühl unbeschwerter Bewegung durch einen Hauch von Misstrauen ersetzt, bildet den Ausgangspunkt von Jonathan Coes neuestem Roman „Der Beweis meiner Unschuld“. Der Autor, den man ohne Übertreibung den „britischsten“ aller zeitgenössischen britischen Schriftsteller nennen darf, kanalisiert darin jenes unterschwellige Unbehagen, das den öffentlichen Raum längst in eine Bühne gegenseitiger Kontrolle verwandelt hat und verwandelt es in eine bitter-komische Reflexion über die Kultur seines Landes und die Sinnfrage des literarischen Schreibens selbst.
Wie so oft in seinem Werk gelingt es Coe, die politische und gesellschaftliche Realität seines Landes in eine Erzählung zu verwandeln, die gleichermaßen unterhält, aufrüttelt und melancholisch stimmt. Schauplatz ist eine der trostlosesten Phasen jüngerer britischer Geschichte: die kurze, aber folgenreiche Regierung von Liz Truss. In jenen sieben Wochen, in denen sich politische Unfähigkeit und ökonomische Hybris zu einem nationalen Fanal verdichteten, siedelt Coe seine Handlung an, präzise datiert zwischen dem 6. September und dem 25. Oktober 2022, also jenem kurzen Interregnum zwischen dem Tod der Königin und dem moralischen Niedergang der konservativen Partei.
Im Zentrum steht die 23-jährige Phil, die nach abgeschlossenem Anglistikstudium widerwillig in ihr Elternhaus zurückkehrt, eine Generationenfigur par excellence, gefangen zwischen Bildungsversprechen und prekärem Arbeitsmarkt. Ihre Arbeit bei einer japanischen Fast-Food-Kette am Flughafen Heathrow steht sinnbildlich für die Entwertung geistiger Ambitionen in einer Welt, die Kreativität nur noch in Klickzahlen misst. Sie träumt davon, Schriftstellerin zu werden, schwankt zwischen dem Schreiben eines Krimis und dem Versuch, der „Autofiktion“, jener Modegattung der Selbstbezüglichkeit, gerecht zu werden – und verliert sich dabei im gleichförmigen Trott aus Fernsehwiederholungen und Selbstzweifeln.
Erst der unerwartete Besuch des Journalisten Christopher Swan, einst ein enger Freund ihrer Mutter aus Cambridge-Tagen, bringt Bewegung in ihr Leben. Begleitet von seiner Adoptivtochter Rashida reist Swan zu einer dreitägigen Konferenz namens TrueCon (kurz für True Conservative), einem satirischen Spiegelbild jener Denkfabriken, die Großbritannien in den letzten Jahren immer weiter nach rechts gerückt haben. Coe gelingt hier eine grandiose Parodie auf den politischen Zeitgeist, der sich moralischer Prinzipien längst entledigt hat und stattdessen auf Schlagworte und Selbstgerechtigkeit setzt.
Swan, der als Historiker und Blogger die ideologische Erosion des britischen Konservatismus seit der Thatcher-Ära akribisch dokumentiert hat, gerät in den Fokus der Verschwörer. Als er in einem abgeschiedenen Landhaus tief in den Cotswolds tot aufgefunden wird – in einem Raum, den niemand hätte betreten oder verlassen können – entspinnt sich eine raffinierte Mischung aus klassischer Detektivgeschichte, Gesellschaftssatire und literarischer Selbstbefragung. Die pensionierungsreife Inspektorin Prudence Freeborn übernimmt die Ermittlungen, während Phil und Rashida sich als dilettantische Detektivinnen versuchen. Schritt für Schritt stoßen sie auf ein literarisches Rätsel, das bis in die 1980er Jahre zurückreicht, zu Peter Cockerill, einem vergessenen Schriftsteller, dessen angeblicher Selbstmord sich als Schlüssel zu einem weitaus tiefer liegenden Geheimnis erweist.
Der stärkste Teil des Romans – und zugleich sein emotionales Herzstück – ist Coes Rückblende ins Cambridge der 1980er Jahre, erzählt von Brian Collier, einer Figur von rührender Authentizität. Collier, ein Aufsteiger aus einfachen Verhältnissen, ringt mit dem Widerspruch zwischen Herkunft und akademischem Anspruch. In ihm begegnet man dem literarischen Alter Ego des Autors, einem modernen Arthur Kipps, der die gesellschaftliche Enge ebenso seziert wie die moralische Selbstgefälligkeit der Bildungsbürger. Coe beschreibt diese Welt mit einer Mischung aus Zärtlichkeit und Ironie, mit unbestechlichem Blick für die kleinen Eitelkeiten und die großen Lebenslügen einer Generation, die glaubt, Intellekt allein sei bereits Tugend.
In diesen Passagen zeigt sich der wahre Meister der britischen Gegenwartsliteratur. Jonathan Coe entwirft keine bloße Kriminalgeschichte, sondern eine vielstimmige Chronik der Gegenwart, die von politischer Farce, sozialem Realismus und leiser Melancholie gleichermaßen durchdrungen ist. Seine Sprache ist von präziser Eleganz, sein Humor fein ziseliert, seine Beobachtungsgabe unbestechlich.
Ohne erhobenen Zeigefinger, aber mit messerscharfer Ironie und einem liebevoll-ironischen Blick auf die Schwächen seiner Landsleute, zeichnet Coe das Panorama einer Gesellschaft, die zwischen Nostalgie und Desillusion pendelt. Große und kleine Symbole, die Verehrung des Antlitzes von Königin Elisabeth II., das geduldige Anstehen der Briten, die stille Disziplin des Alltags, verdichten sich zu einem feinen, poetischen Mosaik nationaler Selbstwahrnehmung.
„Der Beweis meiner Unschuld“ ist klug, witzig, vielschichtig, nostalgisch und zugleich tief berührend, eine glänzende Mischung aus Kriminalparodie, Gesellschaftsroman und Selbstreflexion über das Schreiben. Bis Coe sein nächstes Werk vorlegt, bleibt dieser Roman das bislang überzeugendste Zeugnis seines literarischen Könnens; ein Buch, das unterhält, aufklärt und in seiner sanften Ironie doch ein Stück Hoffnung auf Bewahrung britischer Humanität bewahrt.
Meine Bewertung:
Veröffentlicht am 21. Oktober 2025