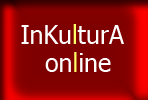Buchkritik -- Jens Lapidus -- Mr. One
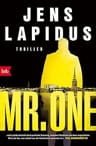 Jens Lapidus’ neuer Roman „Mr. One‟ ist der vierte Teil der Reihe über Teddy und Emelie und ein literarisches Schauspiel aus scharfkantiger Sprache, urbaner Kälte und einer bis ins Letzte durchkomponierten Dramaturgie. Was auf den ersten Blick wie ein konventioneller Gangsterthriller wirkt, entfaltet sich auf der Ebene der Sprache zu einem Kunststück nüchterner Intensität. Lapidus schreibt, als sei jedes Wort eine Patrone, jeder Satz ein Schlag. Die Prosa ist knapp, stakkatoartig, ohne dekorative Ausschweifung. Genau in dieser Kargheit liegt ihre Kraft, kein Ornament, kein unnötiger Umweg, sondern eine radikale Verdichtung, die den Leser zwingt, den Text nicht einfach zu konsumieren, sondern ihn körperlich zu spüren.
Jens Lapidus’ neuer Roman „Mr. One‟ ist der vierte Teil der Reihe über Teddy und Emelie und ein literarisches Schauspiel aus scharfkantiger Sprache, urbaner Kälte und einer bis ins Letzte durchkomponierten Dramaturgie. Was auf den ersten Blick wie ein konventioneller Gangsterthriller wirkt, entfaltet sich auf der Ebene der Sprache zu einem Kunststück nüchterner Intensität. Lapidus schreibt, als sei jedes Wort eine Patrone, jeder Satz ein Schlag. Die Prosa ist knapp, stakkatoartig, ohne dekorative Ausschweifung. Genau in dieser Kargheit liegt ihre Kraft, kein Ornament, kein unnötiger Umweg, sondern eine radikale Verdichtung, die den Leser zwingt, den Text nicht einfach zu konsumieren, sondern ihn körperlich zu spüren.
Man könnte sagen, Lapidus hat den Rhythmus der Großstadt verinnerlicht. Seine Sätze hallen wider wie das Echo von Schritten in einer Betonunterführung; sie sind schroff, kantig, aber von einer suggestiven Musikalität. Die Dialoge wirken wie improvisierte Jazz-Riffs, kurz und lakonisch, doch voller Zwischentöne. Sie tragen die Authentizität des Milieus in sich, denn Lapidus lässt die Figuren in ihrem eigenen Idiom sprechen. Der Slang der Straße, die abgehackten Codes der Unterwelt, die nüchterne, beinahe juristische Sprache in Szenen, die den staatlichen Apparat streifen, all dies bildet ein Mosaik, das nicht nur erzählt, sondern zugleich porträtiert.
Diese Spracharchitektur ist eng mit dem Thema verwoben. Das Machtvakuum, das durch den Rückzug des alternden Isak Nimrod entsteht, wird nicht nur in der Handlung, sondern auch in der sprachlichen Spannung erfahrbar. Die Prosa kennt keinen Leerlauf. Kapitel enden abrupt, wie abgeschnittene Atemzüge, Perspektiven wechseln mit der Wucht einer Schießerei. Lapidus komponiert sein Werk wie eine Montage: grelle Bilder, kurze Szenen, schnelle Schnitte. Der Effekt ist ein permanentes Gefühl der Unruhe, ein literarischer Herzschlag, der das Tempo des Lesens vorgibt.
Bemerkenswert ist auch die moralische Ambivalenz, die sich nicht nur in den Figuren, sondern ebenso in der Sprache selbst ausdrückt. Denn die Welt dieses Romans ist bevölkert von Gestalten, die sämtlich in den Schattenzonen menschlicher Existenz leben. Die Verbrecher sind ohnehin verroht, das ist ihr Geschäft. Doch auch die, die auf der Seite des Rechts zu stehen scheinen, die Polizei, die Staatsanwältin, sind alles andere als integer. Korruption, Zynismus, die Bereitschaft zur skrupellosen Manipulation durchziehen ihr Handeln wie ein Gift. In dieser Landschaft bleibt einzig die Figur der Emelie ein halbwegs unverdorbenes Gegenbild, eine Art moralischer Widerhaken, der die Geschichte davor bewahrt, in völlige Wertelosigkeit abzugleiten. Gerade durch diesen Kontrast wird die moralische Finsternis des übrigen Personals noch deutlicher sichtbar. So auch die ökonomische Oberschicht, die dekadent, abgehoben und zügellos ist. Innerlich hohl und ihren Sinn nur in der schamlosen Demonstration ihres Reichtums findet.
„Mr. One‟ ist deshalb weit mehr als eine Geschichte über einen Unterweltkrieg. Es ist ein sprachliches Experiment, das aufzeigt, wie sehr Rhythmus, Wortwahl und formale Ökonomie die Wahrnehmung einer erzählten Welt prägen können. Lapidus lässt Stockholm in kurzen Sätzen atmen, in Dialogen gären, in Schweigen explodieren. Er hat eine Form gefunden, die nicht nur erzählt, sondern verkörpert. Man liest keine Kriminalhandlung, man lebt sie mit, Satz für Satz.
So wird aus dem Thriller ein literarischer Kommentar. Lapidus’ Sprache ist nicht bloß Medium, sie ist Substanz: kalt, präzise, schneidend, mit einer Energie, die zugleich bedrückend und faszinierend wirkt. „Mr. One‟ beweist, dass sich Spannungsliteratur längst nicht mehr im Bereich des bloßen Plots erschöpft, sondern in der Art, wie Sprache Welten erschafft, und wie diese Welten uns, die Leser, unentrinnbar gefangen nehmen.
Meine Bewertung:
Veröffentlicht am 19. August 2025