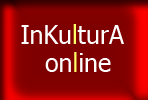Buchkritik -- Gerald Grosz -- Merkels Werk - Unser Untergang
 Gerald Grosz hat nie den Ruf angestrebt, ein leiser Denker zu sein. Wer seine Texte aufschlägt, muss wissen, dass hier kein Wächter der Ausgewogenheit zu Wort kommt, sondern ein Trommler, ein Stoßtruppführer des polemischen Satzes. „Merkels Werk, Unser Untergang“ ist schon durch seinen Titel – mit der blutigen Merkel-Raute als Cover – eine Herausforderung, eine Provokation, ein Schlag ins Gesicht der „politisch Korrekten‟, der „moralisch Höherstehenden‟, die in den vergangenen Jahren aus jedem Kritiker der ungebremsten Einwanderung in die Sozialsysteme einen rechtsextremen Verfassungsfeind gemacht haben. Grosz spricht Klartext, wählt dazu den Vorschlaghammer, nicht das Skalpell, und genau das verleiht diesem Buch eine eignzigartige Frische in einer Debatte, die sonst zu gern im Phrasendunst der diplomatischen Formeln steckenbleibt.
Gerald Grosz hat nie den Ruf angestrebt, ein leiser Denker zu sein. Wer seine Texte aufschlägt, muss wissen, dass hier kein Wächter der Ausgewogenheit zu Wort kommt, sondern ein Trommler, ein Stoßtruppführer des polemischen Satzes. „Merkels Werk, Unser Untergang“ ist schon durch seinen Titel – mit der blutigen Merkel-Raute als Cover – eine Herausforderung, eine Provokation, ein Schlag ins Gesicht der „politisch Korrekten‟, der „moralisch Höherstehenden‟, die in den vergangenen Jahren aus jedem Kritiker der ungebremsten Einwanderung in die Sozialsysteme einen rechtsextremen Verfassungsfeind gemacht haben. Grosz spricht Klartext, wählt dazu den Vorschlaghammer, nicht das Skalpell, und genau das verleiht diesem Buch eine eignzigartige Frische in einer Debatte, die sonst zu gern im Phrasendunst der diplomatischen Formeln steckenbleibt.
Zehn Jahre sind vergangen seit jenem Satz, der zum Mantra einer ganzen Epoche gerann: „Wir schaffen das.“ Damals, im Spätsommer 2015, wurde die deutsche Kanzlerin für ihre Worte bejubelt, verklärt und zum moralischen Leuchtturm Europas erhoben. Heute, ein Jahrzehnt später, ist die Euphorie verdampft und was bleibt, sind unzählige Streitfragen: Was haben wir geschafft? Was haben wir verloren? Und wie hoch war der Preis?
Grosz stellt sich diesen Fragen nicht in der Manier eines Historikers, der Archive ordnet, Quellen abwägt und Deutungen vorsichtig justiert. Nein, er erhebt sich als Ankläger und verortet die damalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel als Hauptverantwortliche für einen politischen Irrweg, der, so seine These, Deutschland und Europa langfristig destabilisiert habe. Diese Klarheit mögen die üblichen Verdächtigen für übertrieben halten, doch gerade ihre Unbedingtheit macht die Lektüre empfehlenswert. Hier wagt jemand, was die etablierten Milieus meist vermeiden, nämlich die ungeschminkte Konfrontation.
So wird aus z. B. aus den „Einzelfällen‟ des polit-medialen Kartells ein Massenphänomen, das täglich weitere autochthone Opfer fordert, die Täter jedoch oft, zu oft, mit juristischer Nachsicht rechnen können.
Das Buch ist ein Pamphlet im klassischen Sinne, und das ist keineswegs abwertend gemeint. Es ist kunstvoll konstruiert: Kapitel wie Hammerschläge, kurze Absätze wie Dolchstöße, rhetorische Zuspitzungen, die im Ohr nachhallen. Grosz beherrscht die Dramaturgie des Aufschreis. Er beginnt bei 2015 als dem „Stichtag der Naivität“ und rollt die Jahre bis 2025 ab wie ein Lehrstück, das zeigen soll, wie aus einem Moment der Willkommensgeste ein Jahrzehnt des Kontrollverlustes geworden ist.
Man könnte ihm Simplifizierung vorwerfen, und man hätte recht. Doch Simplifizierung ist das Geschäft des Pamphlets, nicht sein Makel. Was dem Wissenschaftler als Schwäche gilt, ist hier die eigentliche Stärke: der Mut, Komplexität zu verknappen, um einen Gedanken mit maximaler Schlagkraft ins öffentliche Bewusstsein zu schleudern.
Gerald Grosz verlässt sich nicht allein auf große Thesen, er nutzt Fallgeschichten, Stimmen, Vignetten aus Politik und Gesellschaft; nicht zuletzt seine eigenen, über Jahre veröffentlichten treffenden Analysen und Bemerkungen. Dadurch gewinnt das Buch Farbe und Kontur. Die Leser begegnen Personen, hören Episoden, die exemplarisch für das Ganze stehen sollen. Ist diese Auswahl repräsentativ? Das sei dahingestellt; auf jeden Fall sorgt sie dafür, dass die Argumentation nicht steril bleibt. Wer liest, hat Bilder im Kopf, und Bilder prägen stärker als statistische Tabellen.
Das eigentlich Faszinierende ist der Tonfall. Grosz schreibt, als stünde er auf einer Tribüne, Mikrofon in der Hand, bereit, den Saal aufzurütteln. Die Sprache ist schneidend, pointiert, doch nie langweilig. Sie ist das Gegenteil jener verquollenen Politbürokratie, die sich in Schachtelsätzen windet, um niemandem weh zu tun. Der Autor will wehtun. Er will provozieren, spalten, zum Widerspruch reizen. In einer Öffentlichkeit, die zunehmend auf Harmonie und Empfindlichkeit geeicht ist, ist das fast schon ein Dienst am Gemeinwesen; er zwingt zur Stellungnahme.
Dass das Buch parteiisch ist, bestreitet Gerald Grosz nicht. Im Gegenteil: Er trägt seine Parteilichkeit wie eine Rüstung. Er will keine Mitte, er will kein Konsenspapier. Er will ein Fanal, ein Kontra, eine Alternative zur gängigen Erzählung. Genau darin liegt seine Qualität. Es ist ein Buch für Leser, die es leid sind, in Fußnoten zu ertrinken, und stattdessen eine klare, kompromisslose Stimme hören wollen, auch um sich daran zu reiben.
Ob man Grosz zustimmt oder nicht, spielt fast eine Nebenrolle. Denn sein Werk ist schon deshalb interessant, weil es ein Zeitdokument darstellt. Es zeigt, wie stark sich zehn Jahre nach 2015 ein Lager formiert hat, das die damalige Politik nicht als humanitäre Sternstunde, sondern als historische Fehlentscheidung betrachtet. Insofern ist das Buch ein Zeugnis der Gegenöffentlichkeit, jener Stimmen, die im Mainstream selten Resonanz finden, aber im politischen Untergrund seit Jahren wachsen.
Die eigentliche Leistung von „Merkels Werk, Unser Untergang“ besteht darin, dass es mehr ist als ein Buch. Es ist ein Kristallisationspunkt für eine Stimmung, die längst nicht nur eine Randerscheinung ist. Schon seine Existenz zeigt deutlich, dass die Debatte über 2015 keineswegs abgeschlossen ist. Im Gegenteil, sie ist lebendiger denn je. Und wenn man ein Jahrzehnt danach ein solches Werk, eine Ab- und Aufrechnung, in den Händen hält, wird klar: Die deutsche und europäische Öffentlichkeit wird an diesem Thema noch lange arbeiten müssen.
„Merkels Werk, Unser Untergang“ ist kein ausgewogenes Sachbuch, kein neutraler Bericht. Es ist eine Streitschrift und eine wuchtige Anklage. Aber genau in dieser Form liegt sein Reiz. Grosz schreibt mit stilistischer Energie, dramaturgischer Klarheit und publizistischem Mut. Wer eine energische Gegenerzählung zur Migrationspolitik der letzten Dekade sucht, findet hier einen Text, der nicht nur gelesen, sondern diskutiert werden will.
Man muss dem Autor Respekt zu zollen, denn er erfüllt eine Aufgabe, die in einer Demokratie unverzichtbar ist: Er stört die Selbstzufriedenheit, er bricht das Schweigen und er zwingt damit zur Auseinandersetzung. Und so bleibt am Ende weniger die Frage, ob Gerald Grosz recht hat, als vielmehr die Gewissheit, dass es gut ist, dass er dieses Buch geschrieben hat.
Meine Bewertung:
Veröffentlicht am 26. August 2025