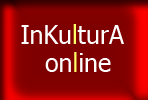Buchkritik -- Olivia Monti -- Die Toten von nebenan
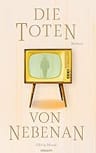 Olivia Montis Roman „Die Toten von nebenan‟ ist ein Werk, das auf leisen Sohlen daherkommt und dennoch eine erstaunliche Wucht entfaltet. Ausgangspunkt ist ein banaler, fast alltäglicher Unfall: Frau Löffler stürzt mit dem Fahrrad und kehrt anschließend nach Hause zurück. Doch die vermeintliche Rückkehr in den gewohnten Alltag erweist sich als Täuschung. Ihr Haus, ihre Nachbarschaft, ihr Viertel sind noch da, doch sie selbst gehört nicht mehr zu den Lebenden. Sie tritt ein in eine Zwischenwelt, in der Verstorbene weiter existieren, unsichtbar für jene, die noch atmen, und dennoch gefangen in der Routine des Alltäglichen. Diese Ausgangslage ist ebenso verstörend wie faszinierend, weil Monti keine große Geste braucht, um das Ungeheuerliche greifbar zu machen. Sie verlegt das Jenseits in die Normalität des Bekannten, in die vertraute Struktur der Vorstadt, wo der Tod nicht Erlösung, sondern eine neue, bedrückende Form von Dauerzustand ist.
Olivia Montis Roman „Die Toten von nebenan‟ ist ein Werk, das auf leisen Sohlen daherkommt und dennoch eine erstaunliche Wucht entfaltet. Ausgangspunkt ist ein banaler, fast alltäglicher Unfall: Frau Löffler stürzt mit dem Fahrrad und kehrt anschließend nach Hause zurück. Doch die vermeintliche Rückkehr in den gewohnten Alltag erweist sich als Täuschung. Ihr Haus, ihre Nachbarschaft, ihr Viertel sind noch da, doch sie selbst gehört nicht mehr zu den Lebenden. Sie tritt ein in eine Zwischenwelt, in der Verstorbene weiter existieren, unsichtbar für jene, die noch atmen, und dennoch gefangen in der Routine des Alltäglichen. Diese Ausgangslage ist ebenso verstörend wie faszinierend, weil Monti keine große Geste braucht, um das Ungeheuerliche greifbar zu machen. Sie verlegt das Jenseits in die Normalität des Bekannten, in die vertraute Struktur der Vorstadt, wo der Tod nicht Erlösung, sondern eine neue, bedrückende Form von Dauerzustand ist.
Monti erzählt all das mit einer Sprache, die weder melodramatisch noch pathetisch ausfällt. Ihr Stil ist nüchtern, beinahe kühl, und gerade darin liegt seine Wirkung. Die Atmosphäre ist von Beginn an von einer eigentümlichen Stille geprägt, einem Schwebezustand, der zwischen Resignation und unterschwelliger Bedrohung oszilliert. Figuren werden knapp umrissen, fast anonymisiert. Sie wirken wie Schattenrisse, deren Konturen gerade ausreichen, um sie voneinander zu unterscheiden, nicht aber, um sie in ihrer Individualität greifbar zu machen. Dieser Kunstgriff ist kein Mangel, sondern Programm. In dieser Parallelgesellschaft geht es weniger um das persönliche Schicksal, als um kollektive Dynamiken, um das Verhalten einer Gemeinschaft, die sich an die Absurdität ihres Zustands gewöhnt hat.
In diese fragile Ordnung tritt mit Herrn Tober ein Neuer. Er ist der Fremde, der Verführer und der Unruhestifter, der den Toten verspricht, sie könnten mehr sein als blasse Nachbarn im Schattenreich, deren Lebensbilanz oft wenig auf der Habenseite vorweist. Er verspricht einen Ausweg und eine Zukunft, doch sein Angebot ist vergiftet; Der Preis dafür ist die Vertreibung der Lebenden. Mit dieser Figur erhält der Roman eine politische Dimension, die subtil bleibt, aber unübersehbar ist. Tober ist ein Demagoge, einer, der Angst in Macht verwandelt, einer, der Gemeinschaft spaltet, indem er ihr einen Sündenbock präsentiert. Die zuvor schweigsame, lethargische Nachbarschaft wird so in einen Strudel von Argwohn, Misstrauen und Versuchung hineingezogen. Die träge Routine verwandelt sich in latente Gewalt.
Gerade in dieser Zuspitzung zeigt sich Montis literarische Stärke. Sie schildert nicht das Spektakuläre, sondern das Schleichende, das unmerklich Drängende. Die Beklemmung entsteht nicht aus grellen Szenen, sondern aus der langsamen Erosion des Vertrauten. Man erkennt darin Mechanismen, die über das erzählerische Szenario hinausweisen. Denn was Monti zeigt, ist eine Parabel auf gesellschaftliche Verführbarkeit, auf die Macht der Angst als soziales Bindemittel. Indem sie ihre Figuren im Jenseits ansiedelt, entzieht sie dem Geschehen jede konkrete Zeitmarke, jede realpolitische Verortung und genau dadurch wird das Gesagte universell.
„Die Toten von nebenan‟ ist damit nicht nur eine literarische Meditation über den Tod, sondern auch über den Menschen in der Gemeinschaft. Was bleibt, wenn der Einzelne in Routinen erstarrt? Was geschieht, wenn ein Fremder von außen neue Deutungen anbietet? Wie dünn ist der Firnis der Gewöhnung, wie schnell wird er von Angst und Verheißung durchstoßen? Monti beantwortet diese Fragen nicht explizit, sie legt ihre Figuren und Szenen so an, dass sie als Spiegel wirken. Der Leser muss selbst erkennen, dass es nicht nur um Verstorbene in einem Viertel geht, sondern um Mechanismen, die uns allen vertraut sind.
So wirkt das Buch weit über seine Handlung hinaus. Es ist keine Geistergeschichte im klassischen Sinn, sondern eine subtile Parabel über Manipulation, Zugehörigkeit und den Preis, den eine Gesellschaft zahlt, wenn sie ihre Sicherheit über ihre Freiheit stellt. Die Schärfe liegt in der Zurückhaltung. Olivia Monti verzichtet auf den moralischen Zeigefinger, sie setzt auf Andeutung, Atmosphäre und auf den Nachhall. Man legt das Buch nicht mit einem Schlusspunkt beiseite, sondern mit einem Fragezeichen. Und dieses Fragezeichen ist stärker als jede eindeutige Antwort.
Es gelingt ihr, den Tod nicht als Ende, sondern als groteske Verlängerung des Lebens zu inszenieren. Ihre Toten sind keine Befreiten, sondern Gefangene eines scheinbar harmlosen, doch zutiefst unheimlichen Alltags. In dieser Normalität des Absurden liegt die eigentliche Beklemmung. „Die Toten von nebenan‟ ist ein Roman, der nicht laut auftritt, sondern still insistiert und dessen Nachhall lange im Bewusstsein bleibt.
Meine Bewertung:
Veröffentlicht am 12. September 2025