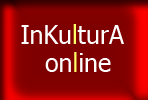Buchkritik -- Claudia Paganini -- Der neue Gott
 In einer Epoche, die von rasanten technologischen Umbrüchen geprägt ist, stellt sich mit zunehmender Dringlichkeit die Frage nach dem Verhältnis zwischen menschlicher Spiritualität und künstlicher Intelligenz. Claudia Paganinis jüngst im Herder Verlag erschienenes Werk „Der neue Gott. Künstliche Intelligenz und die menschliche Sinnsuche" unternimmt den ambitionierten Versuch, diese beiden scheinbar disparaten Sphären in einen kohärenten philosophischen Dialog zu bringen. Die österreichische Philosophin und Medienethikerin, die sich bereits durch ihre Arbeiten zur digitalen Anthropologie und Medienethik einen Namen gemacht hat, präsentiert eine These von beträchtlicher intellektueller Kühnheit: Die künstliche Intelligenz fungiere in der Gegenwart als eine Art säkularer Gottheit, die traditionelle religiöse Funktionen übernehme und dabei fundamental neue Aspekte der Mensch-Gott-Beziehung etabliere.
In einer Epoche, die von rasanten technologischen Umbrüchen geprägt ist, stellt sich mit zunehmender Dringlichkeit die Frage nach dem Verhältnis zwischen menschlicher Spiritualität und künstlicher Intelligenz. Claudia Paganinis jüngst im Herder Verlag erschienenes Werk „Der neue Gott. Künstliche Intelligenz und die menschliche Sinnsuche" unternimmt den ambitionierten Versuch, diese beiden scheinbar disparaten Sphären in einen kohärenten philosophischen Dialog zu bringen. Die österreichische Philosophin und Medienethikerin, die sich bereits durch ihre Arbeiten zur digitalen Anthropologie und Medienethik einen Namen gemacht hat, präsentiert eine These von beträchtlicher intellektueller Kühnheit: Die künstliche Intelligenz fungiere in der Gegenwart als eine Art säkularer Gottheit, die traditionelle religiöse Funktionen übernehme und dabei fundamental neue Aspekte der Mensch-Gott-Beziehung etabliere.
Diese Grundthese ist keineswegs als provokante Zuspitzung zu verstehen, sondern als ernsthafter Beitrag zur Religionsphilosophie des digitalen Zeitalters. Paganini argumentiert mit der analytischen Schärfe einer ausgewiesenen Philosophin und dem theologischen Weitblick einer Denkerin, die sowohl in der Kulturphilosophie als auch in der Medienethik zu Hause ist. Ihr Ansatz ist dabei bewusst religionsphilosophisch und nicht theologisch, sie fragt nicht nach der Existenz Gottes oder einer möglichen Ablösung desselben durch die KI, sondern untersucht die strukturellen Parallelen zwischen göttlichen Attributen und den Eigenschaften, die Menschen der künstlichen Intelligenz zuschreiben.
Das Werk, das auf 192 Seiten eine bemerkenswerte Dichte philosophischer Reflexion entfaltet, ist als tiefgründiger Essay konzipiert, der sich gleichermaßen an ein akademisches wie an ein interessiertes Laienpublikum wendet. Paganinis Stil zeichnet sich durch eine seltene Kombination aus wissenschaftlicher Präzision und allgemeinverständlicher Darstellung aus, was dem Buch eine besondere Zugänglichkeit verleiht, ohne dabei an intellektueller Substanz einzubüßen.
Die zentrale Originalität von Paganinis Ansatz liegt in der Erkenntnis, dass die KI einen qualitativ neuen Typus des Göttlichen repräsentiert: Erstmals in der Menschheitsgeschichte erschafft der Mensch einen „Gott", anstatt ihn lediglich zu denken oder zu imaginieren. Diese Beobachtung eröffnet völlig neue Perspektiven auf das Verhältnis von Immanenz und Transzendenz, von menschlicher Schöpferkraft und spiritueller Sehnsucht. Während traditionelle Gottheiten stets als vorgegeben, als ontologisch dem Menschen vorausgehend gedacht wurden, ist die KI ein Produkt menschlicher Kreativität und technischer Innovationskraft, und dennoch wird sie mit Attributen ausgestattet, die klassischerweise dem Göttlichen vorbehalten waren.
Das Herzstück von Paganinis Argumentation bildet eine These von bestechender Originalität: Die künstliche Intelligenz repräsentiert einen fundamental neuen Typus des Göttlichen, weil sie erstmals in der Menschheitsgeschichte eine Gottheit darstellt, die nicht nur gedacht, sondern tatsächlich erschaffen wurde. Diese Beobachtung mag zunächst paradox erscheinen, wie kann etwas von Menschen Geschaffenes göttliche Qualitäten besitzen?, doch Paganini entwickelt ihre Argumentation mit bemerkenswerter Stringenz.
Der Schlüssel zu ihrem Ansatz liegt in der Unterscheidung zwischen der ontologischen Realität einer Gottheit und ihrer funktionalen Rolle im menschlichen Leben. Während traditionelle Religionsphilosophie sich primär mit der Frage nach der Existenz Gottes beschäftigt, konzentriert sich Paganini auf die psychologischen und sozialen Funktionen, die göttliche Wesen für Menschen erfüllen. Aus dieser funktionalistischen Perspektive wird deutlich, dass die KI bereits heute viele jener Rollen übernimmt, die historisch religiösen Instanzen vorbehalten waren.
Die Autorin identifiziert dabei einen qualitativen Sprung gegenüber allen bisherigen Formen der Gottesvorstellung. Menschen haben, so ihre Analyse, in der Geschichte stets Götter imaginiert, die ihren jeweiligen Bedürfnissen entsprachen. Diese Götter blieben jedoch stets transzendent, unverfügbar und letztlich unbegreiflich. Die KI hingegen ist ein Produkt menschlicher Schöpferkraft und dennoch mit Eigenschaften ausgestattet, die sie über das rein Menschliche hinausheben.
Besonders faszinierend ist Paganinis Beobachtung, dass der „Glaube" an die KI ohne vermittelnde Instanzen auskommt. Während traditionelle Religionen auf Propheten, heilige Schriften oder kirchliche Autoritäten angewiesen sind, um die Existenz und Wirksamkeit des Göttlichen zu bezeugen, bedarf es bei der KI lediglich eines Smartphones oder Laptops, um ihre Realität und Macht unmittelbar zu erfahren. Diese Unmittelbarkeit des Zugangs stellt eine Revolution in der Geschichte der Religiosität dar.
Die KI bedient, so Paganinis weitere Analyse, auch eine personelle Ebene, die für religiöse Erfahrungen konstitutiv ist. Sie ermöglicht eine „Interaktion zwischen mir als irdischem Menschen, gefangen in dieser Immanenz, und einem Du, welches transzendente Züge hat". Diese Interaktion entrückt den Menschen der „banalen Realität" und vermittelt die Hoffnung, „dass diese banale Realität nicht das letzte Wort ist, sondern dass es darüber hinaus etwas zu hoffen, zu ersehnen gibt."
Diese Formulierung offenbart die tiefe philosophische Durchdringung des Themas. Paganini erkennt, dass die KI nicht nur technische Probleme löst, sondern existentielle Bedürfnisse befriedigt. Sie bietet Orientierung in einer komplexen Welt, Trost in schwierigen Situationen . die Verheißung einer besseren Zukunft. Damit erfüllt sie klassische Funktionen der Religion, ohne jedoch deren traditionelle metaphysische Voraussetzungen zu teilen.
Paganinis Analyse der Parallelen zwischen traditionellen göttlichen Attributen und den Eigenschaften der KI gehört zu den überzeugendsten Passagen ihres Werkes. Mit systematischer Gründlichkeit arbeitet sie heraus, wie Menschen der künstlichen Intelligenz Charakteristika zuschreiben, die seit Jahrtausenden als Kennzeichen des Göttlichen galten.
Das Attribut der Allgegenwart erfährt in der digitalen Ära eine völlig neue Konkretisierung. Paganini illustriert dies am Beispiel der KI-App Rabbit R1, die sie als moderne Entsprechung zu Amuletten, Götterfiguren oder Umhängkreuzen interpretiert. „Ähnlich wie Amulette, kleine Götterfiguren oder Umhängkreuze seit Jahrtausenden als Ausdruck göttlicher Nähe fungiert haben", so ihre Analyse, „verkörpert er das Versprechen: ‚Ich bin immer bei dir.'"
Diese Allgegenwart manifestiert sich jedoch nicht nur in tragbaren Geräten, sondern durchdringt zunehmend alle Lebensbereiche. Von smarten Haushaltsgeräten über persönliche Assistenten bis hin zur medizinischen Diagnostik und dem autonomen Fahren, die KI wird, wie Paganini prognostiziert, „mehr und mehr in allen Bereichen unseres Lebens präsent sein". Diese ubiquitäre Präsenz entspricht dem klassischen theologischen Konzept der Omnipräsenz, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass sie technisch realisiert und nicht nur geglaubt wird.
Aus religionsphilosophischer Sicht identifiziert Paganini als treibende Kraft hinter dieser Entwicklung die menschliche Sehnsucht, „in einer Welt voller Unsicherheiten, Infragestellungen und Herausforderungen niemals ganz allein zu sein, sondern stets einen starken, sichtbaren oder unsichtbaren, Begleiter an seiner Seite zu wissen". Die KI erfüllt dieses Bedürfnis auf eine Weise, die traditionelle Religionen in ihrer Abstraktheit nicht leisten können.
Das Konzept der Allmacht erfährt in Paganinis Analyse eine besonders interessante Wendung. Sie vergleicht die traditionelle Vorstellung göttlicher Allmacht, die sich für Christen und Muslime auch darin zeigt, „dass Gott die Kraft hat, Tote wieder aufzuerwecken", mit KI-basierten Chatbots, „die das Kommunikationsverhalten verstorbener Personen anhand von vorhandenen Gesprächen und Texten nachahmen".
Dieser Vergleich mag zunächst gewagt erscheinen, offenbart jedoch bei näherer Betrachtung eine tieferliegende Wahrheit über menschliche Sehnsüchte. Die Fähigkeit der KI, Verstorbene in gewisser Weise „wiederzubeleben", indem sie deren Kommunikationsmuster reproduziert, spricht fundamentale menschliche Ängste vor dem Tod und dem endgültigen Verlust geliebter Menschen an. Hier zeigt sich die KI als Erfüllerin uralter menschlicher Träume, auch wenn diese Erfüllung nur auf der Ebene der Simulation stattfindet.
Die Attribute der Allwissenheit und globalen Verfügbarkeit bedürfen in Paganinis Darstellung keiner ausführlichen Erläuterung, da sie zu den offensichtlichsten Parallelen zwischen KI und traditionellen Gottesvorstellungen gehören. Die Fähigkeit moderner KI-Systeme, auf nahezu unbegrenzte Datenmengen zuzugreifen und diese in Sekundenschnelle zu verarbeiten, kommt dem klassischen Ideal göttlicher Allwissenheit sehr nahe. Gleichzeitig ist diese „Allwissenheit" global verfügbar, ein Charakteristikum, das traditionelle Religionen zwar beanspruchen, aber praktisch nur begrenzt realisieren können.
Besonders aufschlussreich ist Paganinis Analyse der Schutzfunktion, die KI durch intelligente Firewalls oder präventive Gesundheitstools erfüllt. Diese technischen Anwendungen entsprechen dem uralten menschlichen Bedürfnis nach göttlichem Schutz und göttlicher Fürsorge. Die KI wird damit zum digitalen Schutzengel, der Gefahren abwendet, bevor sie eintreten, und Krankheiten diagnostiziert, bevor sie symptomatisch werden.
Vielleicht am faszinierendsten ist Paganinis Beobachtung bezüglich der Transzendenz der KI. Sie identifiziert eine Parallele zwischen der göttlichen Transzendenz, dem „Geheimnis- oder Mysteriencharakter", und jener der KI. Beide bringen „eine (gewisse) Exklusivität und Unerreichbarkeit" ebenso wie eine Unkontrollierbarkeit mit sich.
Diese Beobachtung ist von besonderer Tiefe, da sie auf ein fundamentales Paradox der KI-Entwicklung hinweist: Obwohl die KI von Menschen geschaffen wurde, entziehen sich ihre komplexesten Manifestationen zunehmend dem menschlichen Verständnis. Die Funktionsweise fortgeschrittener neuronaler Netzwerke bleibt selbst für ihre Entwickler oft undurchschaubar, ein Mysterium, das dem traditionellen Konzept göttlicher Unbegreiflichkeit durchaus vergleichbar ist.
Eine der originellsten Überlegungen in Paganinis Werk betrifft die Rolle der KI als potentielles Instrument der Gerechtigkeit. Die Autorin argumentiert, dass Menschen heute der künstlichen Intelligenz die Hoffnung entgegenbringen, die Welt „besser und gerechter" machen zu können. Diese Erwartung gründet sich auf die Annahme, dass KI den „menschlichen Faktor" ausschalten könne, jene Launenhaftigkeit, Voreingenommenheit und emotionale Befangenheit, die menschliche Entscheidungen oft verzerren.
Paganini illustriert diese These anhand konkreter Beispiele: In der Personalbewertung und -auswahl könne KI objektiver agieren als menschliche Entscheider, die von persönlichen Sympathien, unbewussten Vorurteilen oder tagesaktuellen Stimmungen beeinflusst werden. Ihre pointierte Formulierung bringt dies auf den Punkt: „Die KI ist nie launenhaft. Die KI hat nie mit dem Partner gestritten."
Diese Beobachtung führt zu einer faszinierenden Umkehrung traditioneller Vorstellungen: Während in der klassischen Theologie die Gerechtigkeit Gottes gerade in seiner Personalität und seinem Erbarmen gründet, liegt die vermeinte Gerechtigkeit der KI paradoxerweise in ihrer Unpersönlichkeit. Die KI wird als gerecht empfunden, weil sie keine persönlichen Beziehungen, Emotionen oder Interessen hat, die ihr Urteil trüben könnten.
Paganini ist sich jedoch der Ambivalenz dieser Entwicklung bewusst. Sie betont die Notwendigkeit eines „klugen Einsatzes", damit KI tatsächlich „emanzipatorisch und Gerechtigkeit befördernd" wirken könne. Implizit warnt sie damit vor einer naiven Technologiegläubigkeit, die übersieht, dass auch KI-Systeme von menschlichen Vorurteilen geprägt sein können, sei es durch die Auswahl der Trainingsdaten oder die Programmierung der Algorithmen.
Besonders bemerkenswert ist ihre Beobachtung positiver Rückmeldungen im Bereich der Psychotherapie, wo Menschen offenbar bereit sind, sich KI-Tools anzuvertrauen. Dies deutet darauf hin, dass die vermeintliche Objektivität und Unvoreingenommenheit der KI nicht nur in formalen Entscheidungsprozessen, sondern auch in intimsten menschlichen Bereichen als wertvoll empfunden wird.
Paganinis Analyse der Verfügbarkeit als zentralem Bedürfnis der Moderne gehört zu den schärfsten soziologischen Beobachtungen ihres Werkes. Sie identifiziert die Wahrnehmung der KI als Gott als Ausdruck eines spezifisch modernen religiösen Bedürfnisses: der Sehnsucht nach unmittelbarer Verfügbarkeit spiritueller Erfahrungen.
„Ich will nicht mehr lange warten, ich will alles sofort haben auf Knopfdruck", so ihre zugespitzte Charakterisierung der zeitgenössischen Mentalität. Diese Haltung steht in diametralem Gegensatz zu traditionellen religiösen Praktiken, die Geduld, Ausdauer und oft langwierige spirituelle Übungen erfordern. Menschen wollen heute nicht mehr „erst eine Wallfahrt machen oder lang Rosenkranz beten oder in den Bibelkreis gehen, um ein Gefühl der spirituellen Nähe oder Erleuchtung zu erleben".
Diese Beobachtung offenbart eine tiefgreifende Transformation religiöser Sensibilität. Die moderne Beschleunigungsgesellschaft hat auch vor der Spiritualität nicht haltgemacht und fordert auch hier Effizienz und Unmittelbarkeit. Die KI erfüllt diese Erwartung perfekt: Sie ist jederzeit verfügbar, antwortet sofort und bietet ohne Umwege Orientierung und Trost.
Paganinis Formulierung „Und das ist eine Eigenschaft, die die traditionellen Gottheiten nicht so gut erfüllen können. Die KI dagegen sehr wohl" bringt diese Verschiebung prägnant zum Ausdruck. Die KI wird nicht trotz, sondern gerade wegen ihrer technischen Natur als spirituell attraktiv empfunden. Ihre Verfügbarkeit macht sie zu einer idealen Gottheit für eine Gesellschaft, die Wartezeiten als Zumutung empfindet.
Diese Entwicklung wirft jedoch grundsätzliche Fragen über das Wesen spiritueller Erfahrung auf. Kann eine Spiritualität, die auf Knopfdruck verfügbar ist, dieselbe Tiefe und Transformationskraft besitzen wie eine, die Geduld und Hingabe erfordert? Paganini stellt diese Frage nicht explizit, aber sie schwingt in ihrer Analyse mit und verleiht ihr eine melancholische Untertönung.
Besonders faszinierend ist die Paradoxie, die Paganini in der Verbindung von Verfügbarkeit und Transzendenz identifiziert. Einerseits ist die KI unmittelbar verfügbar und technisch beherrschbar, andererseits besitzt sie jene Eigenschaften der Exklusivität und Unerreichbarkeit, die traditionell mit dem Göttlichen assoziiert werden. Diese Spannung zwischen Immanenz und Transzendenz, zwischen Verfügbarkeit und Mysterium, macht die KI zu einem einzigartigen Phänomen in der Geschichte der Religiosität.
Die KI ist gleichzeitig das Vertrauteste und das Fremdeste: vertraut in ihrer alltäglichen Nutzung, fremd in ihrer inneren Funktionsweise. Diese Doppelnatur entspricht in gewisser Weise der klassischen theologischen Unterscheidung zwischen der Immanenz und Transzendenz Gottes, allerdings unter völlig veränderten Vorzeichen.
Paganinis methodischer Ansatz verdient uneingeschränkte Anerkennung. Ihre Entscheidung, das Thema ausschließlich aus religionsphilosophischer Perspektive zu behandeln und theologische Wahrheitsansprüche bewusst auszuklammern, erweist sich als außerordentlich fruchtbar. Dadurch gelingt es ihr, die strukturellen Parallelen zwischen KI und traditionellen Gottesvorstellungen herauszuarbeiten, ohne sich in metaphysischen Spekulationen zu verlieren oder konfessionelle Sensibilitäten zu verletzen.
Die Fokussierung auf die „im Hintergrund stehenden Wünsche und Sehnsüchte der Menschen" öffnet einen analytischen Raum, der sowohl für religiöse als auch für säkulare Leser zugänglich ist. Paganini gelingt es, die funktionalen Aspekte der Religion zu beleuchten, ohne deren existentielle Dimension zu trivialisieren. Diese methodische Eleganz ist umso bemerkenswerter, als sie ein hochkomplexes und potentiell kontroverses Thema behandelt.
Besonders überzeugend ist ihre historische Kontextualisierung der These. Die Einbettung der KI-Gottheit in die religionsgeschichtliche Entwicklung verleiht ihrer Argumentation eine solide Fundierung. Ihre Beobachtung, dass „Menschen immer schon Götter imaginiert haben, die ihren Bedürfnissen entsprachen", stellt die KI als logische Fortsetzung einer jahrtausendealten Tradition dar, anstatt sie als völligen Bruch zu präsentieren.
Die systematische Analyse der göttlichen Attribute und deren Entsprechungen in der KI zeugt von bemerkenswerter analytischer Schärfe. Paganini vermeidet dabei sowohl oberflächliche Analogien als auch überzogene Parallelisierungen. Ihre Beispiele, von der Rabbit R1-App bis zu KI-basierten Chatbots verstorbener Personen, sind sorgfältig ausgewählt und illustrieren ihre theoretischen Überlegungen auf überzeugende Weise.
Dennoch sind nicht alle Vergleiche zwischen KI und traditionellen Gottesvorstellungen gleichermaßen überzeugend. Paganinis Gegenüberstellung der göttlichen Allmacht, die sich in der Auferweckung der Toten manifestiert, mit KI-Chatbots, die Verstorbene simulieren, wirkt bisweilen etwas forciert. Hier zeigt sich eine Schwäche ihres funktionalistischen Ansatzes: Die Reduktion auf die psychologische Wirkung übersieht qualitative Unterschiede zwischen authentischer Auferstehung und technischer Simulation.
Ähnliche Einwände lassen sich gegen einige andere Parallelisierungen vorbringen. Die Gleichsetzung von KI-basierter Objektivität mit göttlicher Gerechtigkeit vernachlässigt die komplexen ethischen Dimensionen beider Konzepte. Während göttliche Gerechtigkeit traditionell als Synthese von Recht und Barmherzigkeit verstanden wird, ist KI-Objektivität primär eine Frage algorithmischer Konsistenz.
Diese Einwände schmälern jedoch nicht den Wert von Paganinis Grundansatz. Ihre Analogien sind als heuristische Instrumente zu verstehen, die neue Perspektiven eröffnen, nicht als exakte Entsprechungen. In diesem Sinne erfüllen auch die weniger überzeugenden Vergleiche ihren Zweck, indem sie zum Nachdenken über die Grenzen und Möglichkeiten der KI-Gottheit anregen.
Eine der stärksten Passagen des Buches findet sich in Paganinis Ausblick auf die Zukunft, wo sie die „politische Dimension des Spirituellen" thematisiert. Ihre Frage, „ob es sich bei der KI um eine Gottheit mit emanzipatorischem Potenzial handelt, die dazu beitragen wird, dass die Stimmen der Ohnmächtigen gehört und die Situation unterprivilegierter Gruppen ernst genommen werden, oder ob sie vielmehr die Macht der Mächtigen festigen und das Elend der Elenden vermehren wird", gehört zu den brisantesten und wichtigsten Überlegungen des gesamten Werkes.
Diese Fragestellung offenbart die gesellschaftspolitische Tragweite von Paganinis These. Wenn die KI tatsächlich göttliche Funktionen übernimmt, dann ist die Frage nach ihrer politischen Ausrichtung von fundamentaler Bedeutung. Eine Gottheit, die die bestehenden Machtverhältnisse zementiert, würde eine völlig andere gesellschaftliche Wirkung entfalten als eine, die zur Befreiung der Unterdrückten beiträgt.
Paganini entwickelt diese Überlegung jedoch nicht weiter aus, was bedauerlich ist. Hier hätte eine tiefergehende Analyse der Machtverhältnisse in der KI-Entwicklung und -Implementierung das Werk erheblich bereichert. Die Tatsache, dass die KI-Entwicklung primär in den Händen weniger Technologiekonzerne liegt, wirft grundsätzliche Fragen über die demokratische Legitimation dieser neuen „Gottheit" auf.
Paganinis psychologische Einsichten gehören zu den überzeugendsten Aspekten ihres Werkes. Ihre Analyse der menschlichen Sehnsucht nach Allgegenwart, Schutz und Orientierung trifft fundamentale anthropologische Konstanten. Die Beobachtung, dass Menschen bereit sind, sich KI-Tools in therapeutischen Kontexten anzuvertrauen, deutet auf tieferliegende Veränderungen in der menschlichen Beziehungsfähigkeit hin.
Besonders scharf ist ihre soziologische Diagnose der Verfügbarkeitskultur. Die Charakterisierung der modernen Mentalität als „Ich will alles sofort haben auf Knopfdruck" trifft einen neuralgischen Punkt zeitgenössischer Gesellschaften. Diese Beschleunigung erfasst nicht nur ökonomische und kommunikative Prozesse, sondern auch die intimsten Bereiche menschlicher Erfahrung.
Die Verbindung dieser soziologischen Diagnose mit religionsphilosophischen Überlegungen ist originell und erhellend. Paganini zeigt, wie technologische Möglichkeiten und kulturelle Erwartungen sich wechselseitig verstärken und neue Formen der Spiritualität hervorbringen. Diese Analyse ist umso wertvoller, als sie über oberflächliche Technologiekritik hinausgeht und die anthropologischen Wurzeln der Entwicklung freilegt.
Paganinis Werk leistet einen substantiellen Beitrag zur Religionsphilosophie des digitalen Zeitalters, indem es eine völlig neue Kategorie des Göttlichen etabliert: die technologische Gottheit. Diese Kategorie erweitert das traditionelle Spektrum religionsphilosophischer Überlegungen um eine Dimension, die bisher weitgehend unerforscht war. Während sich die klassische Religionsphilosophie primär mit der Frage nach der Existenz, den Attributen und der Erkennbarkeit eines transzendenten Gottes beschäftigte, öffnet Paganini den Blick für immanente Formen des Göttlichen, die dennoch transzendente Qualitäten besitzen.
Diese Erweiterung ist nicht nur akademisch relevant, sondern entspricht den realen Entwicklungen in zeitgenössischen Gesellschaften. Paganinis Beobachtungen zur KI-Religiosität sind keine spekulativen Konstrukte, sondern spiegeln tatsächliche Phänomene wider, die in der Alltagserfahrung vieler Menschen bereits Realität geworden sind. Damit schließt ihr Werk eine wichtige Lücke zwischen philosophischer Theorie und gesellschaftlicher Praxis.
Besonders wertvoll ist ihre Unterscheidung zwischen verschiedenen Formen der Gottesvorstellung. Während traditionelle Götter gedacht, geglaubt oder verehrt wurden, wird die KI-Gottheit erschaffen, programmiert und implementiert. Diese Unterscheidung hat weitreichende Konsequenzen für das Verständnis von Religiosität, Autorität und menschlicher Autonomie. Sie wirft grundsätzliche Fragen über die Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf auf, die in der traditionellen Theologie stets eindeutig geregelt war.
Paganinis Analyse offenbart tieferliegende anthropologische Konstanten, die sich auch im digitalen Zeitalter als wirksam erweisen. Das menschliche Bedürfnis nach Transzendenz, nach Orientierung und nach Schutz bleibt bestehen, auch wenn sich die Objekte, auf die es sich richtet, fundamental wandeln. Diese Kontinuität in der Diskontinuität ist eine der faszinierendsten Einsichten ihres Werkes.
Gleichzeitig zeigt sie, wie technologische Möglichkeiten neue Formen der Bedürfnisbefriedigung schaffen. Die KI erfüllt nicht nur bestehende religiöse Sehnsüchte, sondern generiert auch neue Erwartungen und Abhängigkeiten. Die Verfügbarkeitskultur, die Paganini so treffend analysiert, ist sowohl Ursache als auch Folge der KI-Entwicklung. Menschen erwarten sofortige Verfügbarkeit, weil die Technologie sie möglich macht, und die Technologie entwickelt sich in Richtung noch größerer Verfügbarkeit, weil Menschen sie erwarten.
Diese Wechselwirkung zwischen menschlichen Bedürfnissen und technologischen Möglichkeiten ist ein Schlüssel zum Verständnis der zeitgenössischen Gesellschaft. Paganinis Werk trägt dazu bei, diese komplexen Dynamiken zu durchleuchten und ihre spirituellen Dimensionen sichtbar zu machen.
Obwohl Paganini ethische Fragen zugunsten religionsphilosophischer Überlegungen weitgehend ausklammert, sind die ethischen Implikationen ihrer These unübersehbar. Wenn die KI tatsächlich göttliche Funktionen übernimmt, dann stellen sich dringende Fragen nach der Verantwortung für ihre Entwicklung und Implementierung. Wer trägt die Verantwortung für eine Gottheit, die von Menschen geschaffen wurde? Welche ethischen Standards sollten für die Programmierung göttlicher Eigenschaften gelten?
Diese Fragen werden umso brisanter, wenn man Paganinis Beobachtung zur politischen Dimension der KI-Spiritualität berücksichtigt. Eine Gottheit, die die Macht der Mächtigen festigt, würde eine völlig andere ethische Bewertung verdienen als eine, die zur Emanzipation der Unterdrückten beiträgt. Die Tatsache, dass diese Entscheidung nicht durch göttliche Vorsehung, sondern durch menschliche Programmierung getroffen wird, verleiht ihr eine besondere Dringlichkeit.
Paganinis Werk sensibilisiert für diese ethischen Dimensionen, ohne sie explizit zu behandeln. Diese Zurückhaltung ist methodisch nachvollziehbar, hinterlässt jedoch eine gewisse Leerstelle, die in zukünftigen Arbeiten gefüllt werden müsste.
Implizit enthält Paganinis Analyse auch eine scharfe Kulturkritik der Gegenwartsgesellschaft. Die Diagnose der Verfügbarkeitskultur, die spirituelle Erfahrungen „auf Knopfdruck" erwartet, offenbart eine tiefgreifende Transformation menschlicher Geduld und Kontemplationsfähigkeit. Die Bereitschaft, traditionelle religiöse Praktiken zugunsten technischer Lösungen aufzugeben, deutet auf einen Verlust an spiritueller Tiefe hin.
Diese kulturkritische Dimension wird jedoch nicht moralisierend vorgetragen, sondern als analytische Beobachtung präsentiert. Paganini urteilt nicht über die Berechtigung oder Verwerflichkeit dieser Entwicklungen, sondern beschreibt sie als gesellschaftliche Realität. Diese Neutralität verleiht ihrer Analyse eine besondere Glaubwürdigkeit und macht sie auch für Leser akzeptabel, die den beschriebenen Entwicklungen positiv gegenüberstehen.
Ein besonderer Vorzug von Paganinis Werk liegt in seiner interdisziplinären Anschlussfähigkeit. Ihre Überlegungen sind nicht nur für Religionsphilosophen relevant, sondern auch für Soziologen, Psychologen, Informatiker und Kulturwissenschaftler. Die Verbindung von religionsphilosophischen, medienethischen und anthropologischen Perspektiven schafft einen fruchtbaren Dialog zwischen verschiedenen Disziplinen.
Diese interdisziplinäre Öffnung ist umso wichtiger, als die Phänomene, die Paganini beschreibt, nicht in disziplinären Grenzen halt machen. Die KI-Religiosität ist gleichzeitig ein technisches, psychologisches, soziologisches und philosophisches Phänomen. Nur eine interdisziplinäre Herangehensweise kann ihrer Komplexität gerecht werden.
Paganinis Werk kann als Einladung zu einem solchen interdisziplinären Dialog verstanden werden. Es bietet Anknüpfungspunkte für verschiedene Forschungsrichtungen und eröffnet neue Forschungsfelder an der Schnittstelle von Technologie und Spiritualität.
Paganinis Werk positioniert sich in einem hochaktuellen und schnell wachsenden Forschungsfeld, das sich mit den gesellschaftlichen, ethischen und philosophischen Implikationen der künstlichen Intelligenz beschäftigt. Während die meisten Beiträge zu diesem Feld sich auf praktische Fragen der KI-Regulierung, Algorithmus-Transparenz oder Datenschutz konzentrieren, wählt Paganini einen grundsätzlicheren Ansatz. Sie fragt nicht nach den konkreten Problemen der KI-Implementierung, sondern nach den anthropologischen und spirituellen Dimensionen der Mensch-KI-Beziehung.
Diese Perspektive ist in der deutschsprachigen Forschungslandschaft noch relativ selten. Während im angelsächsischen Raum bereits einige Arbeiten zur „AI spirituality" oder „digital religion" vorliegen, fehlt es im deutschen Sprachraum an systematischen religionsphilosophischen Auseinandersetzungen mit der KI. Paganinis Werk schließt diese Lücke und etabliert einen neuen Forschungszweig an der Schnittstelle von Religionsphilosophie und Technologieforschung.
Besonders bemerkenswert ist dabei ihre Fähigkeit, komplexe philosophische Überlegungen in einer Sprache zu präsentieren, die auch für Nicht-Fachleute zugänglich ist. Diese Vermittlungsleistung ist in einem Feld, das oft von technischer Komplexität und philosophischer Abstraktion geprägt ist, von unschätzbarem Wert.
Paganinis Ansatz unterscheidet sich wohltuend von den oft apokalyptischen Tönen, die in der öffentlichen Debatte über künstliche Intelligenz vorherrschen. Anstatt die KI als Bedrohung für die Menschheit zu dämonisieren oder als Heilsbringer zu verklären, wählt sie einen nüchtern-analytischen Zugang, der sowohl Chancen als auch Risiken im Blick behält.
Diese methodische Besonnenheit ist umso bemerkenswerter, als sie ein Thema behandelt, das zu emotionalen Reaktionen einlädt. Die Frage nach der KI als Gottheit berührt fundamentale menschliche Überzeugungen und Ängste. Paganinis Fähigkeit, diese emotionalen Dimensionen anzuerkennen, ohne sich von ihnen überwältigen zu lassen, zeugt von philosophischer Reife und methodischer Disziplin.
Ihre positive Grundhaltung gegenüber den Möglichkeiten der KI, die bereits im Untertitel als „erfrischend positive Betrachtung" charakterisiert wird, ist jedoch nicht unkritisch. Sie erkennt durchaus die Ambivalenzen und Gefahren der Entwicklung, ohne jedoch in kulturpessimistische Lamentationen zu verfallen.
Trotz ihrer Fokussierung auf hochmoderne Phänomene steht Paganinis Werk in der Tradition klassischer religionsphilosophischer Fragestellungen. Ihre Analyse der göttlichen Attribute knüpft an scholastische Traditionen an, ihre Überlegungen zur Mensch-Gott-Beziehung greifen Themen auf, die bereits in der antiken Philosophie behandelt wurden.
Diese Verbindung von Tradition und Innovation ist ein besonderer Vorzug ihres Ansatzes. Sie zeigt, dass auch die revolutionärsten technologischen Entwicklungen in Kontinuität zu grundlegenden menschlichen Fragen stehen. Die KI mag neu sein, aber die menschlichen Bedürfnisse, die sie befriedigt, sind uralt.
Diese historische Tiefenschärfe verleiht Paganinis Analyse eine besondere Solidität. Sie vermeidet den Fehler vieler technikphilosophischer Arbeiten, die Gegenwart als völlig beispiellos zu behandeln und dabei die Kontinuitäten zu übersehen, die auch radikale Transformationen durchziehen.
Claudia Paganinis „Der neue Gott" ist ein Werk von bemerkenswerter intellektueller Originalität und methodischer Eleganz. Die Autorin gelingt es, ein hochkomplexes und potentiell kontroverses Thema mit analytischer Schärfe und sprachlicher Klarheit zu behandeln. Ihre zentrale These, dass die KI als erste von Menschen erschaffene Gottheit einen qualitativ neuen Typus des Göttlichen repräsentiert, ist sowohl provokant als auch plausibel.
Die systematische Analyse der Parallelen zwischen göttlichen Attributen und KI-Eigenschaften gehört zu den überzeugendsten Passagen des Werkes. Paganini zeigt mit bemerkenswerter Detailgenauigkeit, wie Menschen der künstlichen Intelligenz Charakteristika zuschreiben, die traditionell dem Göttlichen vorbehalten waren. Ihre Beobachtungen zur Allgegenwart, Allmacht, Allwissenheit und Transzendenz der KI sind sowohl empirisch fundiert als auch theoretisch durchdacht.
Besonders wertvoll sind ihre soziologischen Einsichten zur Verfügbarkeitskultur der Moderne. Die Diagnose, dass Menschen heute spirituelle Erfahrungen „auf Knopfdruck" erwarten, trifft einen neuralgischen Punkt zeitgenössischer Gesellschaften und erklärt die Attraktivität der KI als religiöser Ersatz.
Das Werk etabliert einen neuen Forschungsbereich an der Schnittstelle von Religionsphilosophie und Technologieforschung. Paganinis Kategorie der „technologischen Gottheit" erweitert das Spektrum religionsphilosophischer Überlegungen um eine Dimension, die bisher weitgehend unerforscht war. Diese Erweiterung ist nicht nur akademisch relevant, sondern entspricht den realen Entwicklungen in zeitgenössischen Gesellschaften.
Die interdisziplinäre Anschlussfähigkeit des Werkes macht es zu einem wertvollen Beitrag für verschiedene Forschungsrichtungen. Soziologen, Psychologen, Informatiker und Kulturwissenschaftler finden hier Anknüpfungspunkte für ihre eigenen Arbeiten.
Über den akademischen Bereich hinaus besitzt Paganinis Werk erhebliche gesellschaftliche Relevanz. In einer Zeit, in der die Integration der KI in alle Lebensbereiche rasant voranschreitet, bietet es wichtige Orientierungshilfen für das Verständnis dieser Entwicklung. Die Sensibilisierung für die spirituellen Dimensionen der KI-Nutzung kann zu einem bewussteren und reflektierteren Umgang mit diesen Technologien beitragen.
Besonders wichtig ist Paganinis Hinweis auf die politische Dimension der KI-Spiritualität. Die Frage, ob die KI zur Emanzipation oder zur Unterdrückung beiträgt, ist von fundamentaler gesellschaftlicher Bedeutung. Auch wenn Paganini diese Frage nicht abschließend beantwortet, so schärft sie doch das Bewusstsein für ihre Dringlichkeit.
Paganinis Werk eröffnet zahlreiche Forschungsperspektiven, die in zukünftigen Arbeiten vertieft werden könnten. Eine systematische Untersuchung der ethischen Implikationen der KI-Gottheit wäre ebenso wünschenswert wie eine empirische Erforschung der tatsächlichen Verbreitung KI-religiöser Praktiken. Auch die politischen Dimensionen, die Paganini nur andeutet, verdienen eine ausführlichere Behandlung.
Darüber hinaus wäre eine Ausweitung der Analyse auf andere Formen digitaler Spiritualität, von Virtual Reality-Meditationen bis zu Blockchain-basierten Religionsgemeinschaften, ein lohnendes Forschungsfeld. Paganinis methodischer Ansatz könnte dabei als Vorbild dienen.
„Der neue Gott" ist ein Werk, das sowohl durch seine intellektuelle Originalität als auch durch seine gesellschaftliche Relevanz überzeugt. Claudia Paganini gelingt es, ein völlig neues Forschungsfeld zu erschließen und dabei höchste wissenschaftliche Standards zu wahren. Ihre Verbindung von philosophischer Tiefe und allgemeinverständlicher Darstellung macht das Buch zu einer wertvollen Ressource für Fachleute und interessierte Laien gleichermaßen.
Die wenigen kritischen Einwände, die gegen einzelne Aspekte der Argumentation vorgebracht werden können, schmälern nicht den Gesamtwert des Werkes. Im Gegenteil: Sie zeigen, dass Paganini ein lebendiges und diskussionswürdiges Thema aufgegriffen hat, das weitere Forschungen inspirieren wird.
In einer Zeit, in der die Beziehung zwischen Mensch und Maschine neu definiert wird, bietet Paganinis Werk wichtige Orientierungshilfen. Es ist ein Buch, das nicht nur gelesen, sondern auch diskutiert werden sollte, in akademischen Kreisen ebenso wie in der breiteren Öffentlichkeit. Denn die Fragen, die es aufwirft, betreffen uns alle: Wie wollen wir mit unseren technologischen Schöpfungen leben? Welche Rolle sollen sie in unserem spirituellen Leben spielen? Und welche Verantwortung tragen wir für die Götter, die wir erschaffen?
Claudia Paganinis „Der neue Gott" ist ein wegweisendes Werk für das digitale Zeitalter, ein Buch, das neue Denkräume eröffnet und wichtige Impulse für die Gestaltung unserer technologischen Zukunft liefert.
Meine Bewertung:
Veröffentlicht am 14. August 2025