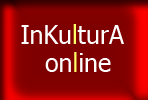Buchkritik -- Julia Ruhs -- Links-grüne Meinungsmacht
 Die Freiheit der Meinung ist ein hohes Gut, doch sie ist kein statisches Prinzip, das allein durch seine Verankerung im Grundgesetz Bestand hätte. Sie lebt von der Kultur, die sie trägt. Julia Ruhs hat in ihrem Buch „Links-Grüne Meinungsmacht – Die Spaltung unseres Landes“ die Diagnose gestellt, dass diese Kultur in Deutschland ins Wanken geraten ist. Sie beschreibt eine Gesellschaft, in der nicht mehr alle Stimmen das gleiche Gewicht besitzen, sondern in der sich eine Schicht von Deutungsinstanzen herausgebildet hat, die das Feld des Sagbaren reguliert. Ihr Befund lautet, dass sich in Medien, in Parteien und in Institutionen eine links-grün dominierte Hegemonie verfestigt habe, die nicht durch Zwangsgesetze, sondern durch subtilere Mechanismen wirkt: durch Ausgrenzung, soziale Ächtung und durch das permanente Verdikt des moralisch Unanständigen.
Die Freiheit der Meinung ist ein hohes Gut, doch sie ist kein statisches Prinzip, das allein durch seine Verankerung im Grundgesetz Bestand hätte. Sie lebt von der Kultur, die sie trägt. Julia Ruhs hat in ihrem Buch „Links-Grüne Meinungsmacht – Die Spaltung unseres Landes“ die Diagnose gestellt, dass diese Kultur in Deutschland ins Wanken geraten ist. Sie beschreibt eine Gesellschaft, in der nicht mehr alle Stimmen das gleiche Gewicht besitzen, sondern in der sich eine Schicht von Deutungsinstanzen herausgebildet hat, die das Feld des Sagbaren reguliert. Ihr Befund lautet, dass sich in Medien, in Parteien und in Institutionen eine links-grün dominierte Hegemonie verfestigt habe, die nicht durch Zwangsgesetze, sondern durch subtilere Mechanismen wirkt: durch Ausgrenzung, soziale Ächtung und durch das permanente Verdikt des moralisch Unanständigen.
Das Entscheidende an Ruhs’ Analyse ist, dass sie die Mechanismen der Selbstzensur offenlegt. Menschen, die merken, dass ihre Ansichten nicht in das schmale Fenster des „Akzeptablen“ passen, sprechen nicht mehr frei, sondern passen sich an oder schweigen. Diese Tendenz ist gefährlich, weil sie den öffentlichen Raum verengt. Wo sich Bürger nicht mehr trauen, Überzeugungen zu artikulieren, dort stirbt das demokratische Gespräch, und die politische Debatte verkommt zu einem Ritual der Bestätigung dessen, was ohnehin schon als normativ gilt. Die von Ruhs beschriebene „Meinungsmacht“ ist nicht bloß ein abstrakter Begriff, sondern sie wirkt in den alltäglichen Erfahrungen: im Shitstorm, der jedem droht, der die falsche Frage stellt, in der Karriererisiko-Warnung für Journalisten, die sich kritisch äußern, oder in der plötzlichen Distanzierung von Kollegen, wenn jemand zu sehr gegen den Strom schwimmt.
Besonders aufschlussreich wird diese Dynamik im Fall ihres eigenen Formats „Klar“, das beim NDR in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk gestartet wurde. Die Grundidee war, strittige Fragen offen, klar und ohne ideologisch gefärbte Scheuklappen zu verhandeln. Das Publikum honorierte diesen Ansatz: die Einschaltquoten und Umfragen zeigten eine deutliche Zustimmung. Doch während Zuschauer das Format als wohltuende Alternative zur weichgespülten Diskurskost empfanden, erhob sich innerhalb des NDR massiver Widerstand. Rund 250 Mitarbeiter unterschrieben ein internes Schreiben, das die Sendung missbilligte, nicht aufgrund journalistischer Fehler, sondern weil die Art der Fragestellung und die Bandbreite der Meinungen als zu „rechts“ eingestuft wurden. In der Folge wurde Ruhs aus der Moderation der NDR-Ausgaben entfernt, während sie beim BR vorerst weitermoderieren darf.
Diese Episode ist symptomatisch für das, was Ruhs in ihrem Buch beschreibt. Nicht das Publikum, nicht der Bürger, dem man angeblich dienen will, entscheidet über das Fortbestehen eines Formats, sondern ein interner Gesinnungskorridor. Die Absetzung ist ein Beispiel dafür, wie institutionalisierte Meinungsmacht wirkt: Sie tarnt sich als redaktionelle Verantwortung, sie beruft sich auf Programmkriterien, sie spricht in der Sprache der Ausgewogenheit, doch ihr Effekt ist die Verdrängung unbequemer Stimmen. Für Ruhs ist dies kein Einzelfall, sondern Ausdruck einer Tendenz, die sich seit Jahren verfestigt.
Ihre Thesen gewinnen Plausibilität nicht zuletzt dadurch, dass sie kein abstraktes Bedrohungsszenario an die Wand malt, sondern konkrete Beispiele liefert, die jeder nachprüfen kann. Die wachsende Distanz vieler Bürger zu den öffentlich-rechtlichen Anstalten, das schwindende Vertrauen in die journalistische Neutralität, die Beobachtung, dass politische Debatten in Talkshows fast immer mit denselben Personen und denselben Sichtweisen geführt werden, all das sind Indizien, die Ruhs’ Diagnose stützen. Der Ausschluss konservativer, skeptischer oder unpopulärer Meinungen aus den Leitmedien führt nicht zu mehr gesellschaftlicher Harmonie, sondern zur Spaltung. Wer sich nicht repräsentiert fühlt, sucht Alternativen, sei es in neuen Medien, sei es in politischen Bewegungen, die sich gerade aus dem Gefühl speisen, gegen eine übermächtige Kulturfront zu kämpfen.
Ruhs’ Buch ist deshalb mehr als ein persönlicher Erfahrungsbericht, es ist ein Weckruf. Die Demokratie braucht Vielfalt des Denkens und die Bereitschaft, auch dem Widerspruch Raum zu geben. Eine Kultur, die nur das bestätigt, was moralisch genehmigt ist, erzeugt keine mündigen Bürger, sondern schüchtert ein. Der Fall „Klar“ macht deutlich, dass der Kampf um Meinungsfreiheit längst nicht mehr eine Frage ferner politischer Extreme ist, sondern im Herzen unserer Medienlandschaft ausgetragen wird. Wenn eine Moderatorin, die sich erkennbar um sachliche Balance bemüht, durch den Druck interner Strömungen ins Abseits gedrängt wird, dann ist dies nicht nur ein persönliches Schicksal, sondern ein Signal: Hier wird markiert, was sagbar ist und was nicht.
Ruhs’ Thesen wirken in diesem Licht nicht wie Übertreibungen, sondern wie nüchterne Bestandsaufnahme. Sie zeigt auf, dass Meinungsfreiheit nicht allein durch juristische Garantien gesichert ist. Sie lebt davon, dass Menschen sie täglich praktizieren können, ohne Sanktionen fürchten zu müssen. Wo aber die Sanktionen subtil, sozial und institutionell wirksam werden, da beginnt die Erosion. Wer diese Warnung ignoriert, riskiert, dass die demokratische Streitkultur von innen aushöhlt.
Meine Bewertung:
Veröffentlicht am 30. September 2025