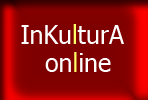Buchkritik -- Vince Ebert -- Wot se Fack, Deutschland?
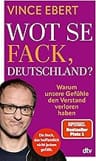 Wenn Comedians auf einmal nicht mehr Mainstream sind…
Wenn Comedians auf einmal nicht mehr Mainstream sind…
Vince Ebert war lange Zeit der sympathische Physiker von nebenan auf den deutschen Kabarettbühnen. Mit Witz und wissenschaftlicher Brille erklärte er uns die Welt, machte komplexe Zusammenhänge verständlich und sorgte für intelligentes Schmunzeln im Mainstream. Der Mann mit der charmanten Trockenheit und dem Rechenschieber im Kopf war so etwas wie der Liebling der naturwissenschaftlich Benachteiligten. Er rechnete vor, er relativierte, er schraubte an den Gesetzen der Physik, bis selbst das Schwerkraftgesetz einen Kabarettpreis verdient hätte. Kurz, Ebert war der populärwissenschaftliche Komiker eines Landes, das sich gern schlau fühlen wollte, ohne dabei zu sehr ins Schwitzen zu geraten.
Doch mit seinem Buch „Wot the Fack, Deutschland?‟ hat er das Terrain gewechselt. Die bequeme Rolle des netten Erklärbären reicht ihm nicht mehr. Statt nur zum Lachen und Lernen einzuladen, fordert er nun: Lachen und Aufregen. Die Pointe ist nicht mehr bloß der Zucker, der das Wissen versüßt. Sie ist das Skalpell, mit dem er eine Diagnose stellt: Deutschland leidet an einer chronischen Krankheit, deren Name längst sprichwörtlich ist, „German Angst“.
Diese Angst ist kein diffuses Unbehagen, sondern eine nationale Grundhaltung. Sie äußert sich in der Vollkasko-Mentalität, in der Tendenz, Risiken nicht nur zu minimieren, sondern um jeden Preis zu vermeiden. Das Ergebnis ist eine Gesellschaft, die alles absichern will und dabei jede Form von Abenteuer, Mut oder unternehmerischem Risiko im Keim erstickt. Fortschritt wird nicht mehr gewagt, sondern beargwöhnt. Spontaneität gilt als gefährlich, Neugier als naiv.
Ebert beschreibt ein Land, das Sicherheit über Freiheit stellt, Regulierung über Innovation, Bedenken über Tatkraft. Während anderswo experimentiert, verworfen, neu erfunden wird, perfektioniert man hierzulande den Prüfprozess. Das Ideal ist nicht das Neue, sondern das Fehlerfreie, und damit eben auch das Stagnierende. Wer den Mut hat, Visionen zu entwickeln, findet sich schnell im Verhörsaal der Skeptiker wieder: „Was, wenn es nicht klappt? Was, wenn es schiefgeht? Was, wenn es jemanden verletzt?“ Das deutsche „Was, wenn“ ist stärker als jedes „Warum nicht“.
In dieser Diagnose liegt die eigentliche Provokation. Denn Ebert, der einst das Lachen im Dienste der Physik verkaufte, verlässt mit diesem Buch die Komfortzone des Konsenshumors. Er provoziert. Er nennt Verantwortliche: eine ausufernde Bürokratie, die Regeln schafft wie am Fließband; eine Politik, die lieber in Symbolpolitik investiert, als sich der Realität zu stellen; und eine mediale Öffentlichkeit, die Erregung als Geschäftsmodell entdeckt hat. Wo früher der Comedian den kleinsten gemeinsamen Nenner suchte, um alle zum Lachen zu bringen, sucht er nun bewusst die Reibung.
Das Besondere ist, dass er sich nicht mit abstrakten Begriffen begnügt, sondern konkrete Beispiele wählt. Er fragt, warum bahnbrechende Innovationen wie das iPhone oder die mRNA-Technologie, deren Ursprünge auch deutsche Forscherhandschrift tragen, letztlich nicht hier, sondern in den USA zur Marktreife gelangten. Seine Antwort ist scharf wie simpel: Weil hierzulande die Bedenkenträger lauter sind als die Visionäre. Deutschland hört lieber auf den Skeptiker, der alles Gefährliche anmahnt, als auf den Gestalter, der alles Mögliche ausprobiert.
Das Buch ist voll solcher Beispiele. Mal sind es große technologische Fragen, mal scheinbar banale Alltagsdebatten. Etwa, wenn Ebert beschreibt, wie sich das Land in endlosen Diskussionen über Gender-Sprache oder über die „richtige“ Form der Nachhaltigkeit verliert, während gleichzeitig die großen Herausforderungen, von Digitalisierung bis Energiesicherheit, ungelöst im Raum stehen. Solche Nebenschauplätze werden zu nationalen Hauptveranstaltungen, weil sie das Gefühl vermitteln, moralisch auf der richtigen Seite zu stehen. Die Mühsal echter Reformen, die Risiken von Experimenten, all das lässt sich so elegant verdrängen.
Für Ebert ist diese Haltung ein Symptom jener irrationalen Emotionalisierung, die sich wie eine Tarnkappe über die Politik gelegt hat. Er argumentiert: Sobald Gefühle wichtiger sind als Fakten, kann Rationalität nur verlieren. Als Physiker stört ihn besonders, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse den moralischen Dogmen geopfert werden. Er beobachtet eine Gesellschaft, die sich lieber in ritueller Empörung wärmt, als nüchtern Daten zur Kenntnis zu nehmen. Sein Ruf nach einer Rückkehr zum faktenbasierten Diskurs ist daher nicht nur eine akademische Floskel, sondern der Kern seines Anliegens.
Dabei bleibt der Ton des Buches keineswegs bitter oder verbissen. Im Gegenteil: Ebert schreibt mit jener trocken-ironischen Gelassenheit, die seine Auftritte auf der Bühne immer ausgezeichnet hat. Man lacht, man fühlt sich ertappt, man nickt, und wird gleichzeitig unruhig. Genau darin liegt die Kraft des Buches: Es ist keine Predigt, sondern ein Gespräch mit scharfem Humor, in dem das Lachen wie ein Schutzschild wirkt, damit die Wahrheit nicht allzu schmerzhaft einschlägt.
Wer das Buch liest, spürt schnell, dass Ebert damit seinen Mainstream-Status riskiert. Das Publikum, das ihn bisher liebte, weil er Wissenschaft verständlich machte und dabei stets harmlos blieb, könnte sich nun irritiert abwenden. Denn „Wot the Fack, Deutschland?‟ ist nicht harmlos. Es nimmt Partei. Es fordert heraus. Es zwingt dazu, sich zu positionieren. Wer nur leichte Unterhaltung erwartet, wird enttäuscht sein. Wer sich aber nach klarem Denken sehnt, wird sich bestätigt fühlen.
So wird aus dem einstigen Publikumsliebling ein Mahner, der unbequeme Wahrheiten ausspricht. Er verliert vielleicht Zuschauer, die nur unbeschwert lachen wollen, gewinnt aber eine neue Leserschaft, die seine Frustration über den Zustand des Landes teilt. Damit verkörpert Ebert einen Wandel, der weit über ihn hinausweist: In einer Zeit, in der das Kabarett oft zum ritualisierten Abnicken verkommen ist, in der Pointen wie Pflichtübungen wirken, wagt einer den Schritt ins Risiko.
Genau das macht das Buch so relevant. Es ist ein Paradebeispiel dafür, was passiert, wenn ein Comedian beschließt, seinen Mainstream-Status zu opfern, um Haltung zu zeigen. Er wird nicht mehr nur der nette Mann, der mit Physik und Pointen jongliert, sondern zur Stimme einer stillen, oft frustrierten Mitte, die genug hat von Bedenkenträgerei, Regelungswut und Empörungsritualen.
Und so liest sich „Wot the Fack, Deutschland?‟letztlich wie ein Weckruf. Nicht laut, nicht schrill, sondern mit trockenem Humor, der nachhaltiger wirkt als jedes Pathos. Es ist die Einladung, den Verstand nicht zu verlernen, das Risiko nicht zu fürchten, die Freiheit nicht dem Sicherheitsdenken zu opfern. Vince Ebert erinnert daran, dass man lachen kann, und dennoch ernst bleiben muss.
Vielleicht ist das die eigentliche Pointe: Wenn Comedians nicht mehr Mainstream sind, sondern die letzte Bastion des gesunden Menschenverstands, dann haben wir Grund zur Sorge. Aber vielleicht auch Hoffnung. Denn solange jemand wie Vince Ebert es wagt, diese Rolle einzunehmen, besteht die Chance, dass wir uns das Denken nicht ganz abgewöhnen. Und vielleicht, ganz vielleicht, bleibt uns dann sogar das Lachen erhalten.
Meine Bewertung:
Veröffentlicht am 11. September 2025