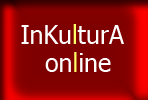Buchkritik -- Konrad Paul Liessmann -- Was nun? - Eine Philosophie der Krise
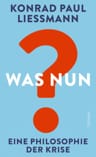 In einer Epoche, die sich in der permanenten Evokation von Krisen zu gefallen scheint und in der der Ausnahmezustand zur neuen Norm zu erstarren droht, erscheint Konrad Paul Liessmanns jüngstes Werk „Was nun? Eine Philosophie der Krise“ als eine ebenso notwendige wie wohltuende Intervention. Der Titel selbst, eine Frage von existenzieller Dringlichkeit, die in ihrer Kürze die ganze Ratlosigkeit einer von multiplen Verunsicherungen heimgesuchten Gesellschaft bündelt, ist programmatisch. Liessmann unternimmt jedoch nicht den Versuch, eine weitere beruhigende oder gar Heilslehre zu verkünden. Vielmehr liefert er eine intellektuelle Zumutung im besten Sinne des Wortes: eine Aufforderung zum eigenständigen Denken.
In einer Epoche, die sich in der permanenten Evokation von Krisen zu gefallen scheint und in der der Ausnahmezustand zur neuen Norm zu erstarren droht, erscheint Konrad Paul Liessmanns jüngstes Werk „Was nun? Eine Philosophie der Krise“ als eine ebenso notwendige wie wohltuende Intervention. Der Titel selbst, eine Frage von existenzieller Dringlichkeit, die in ihrer Kürze die ganze Ratlosigkeit einer von multiplen Verunsicherungen heimgesuchten Gesellschaft bündelt, ist programmatisch. Liessmann unternimmt jedoch nicht den Versuch, eine weitere beruhigende oder gar Heilslehre zu verkünden. Vielmehr liefert er eine intellektuelle Zumutung im besten Sinne des Wortes: eine Aufforderung zum eigenständigen Denken.
Die formale Gestalt des Buches, eine Sammlung von fünfzehn Essays, die zum Teil bereits an anderer Stelle publiziert und für die vorliegende Ausgabe überarbeitet wurden, erweist sich dabei als kongeniale Entsprechung seines Inhalts. Anstatt eine systematische, in sich geschlossene Abhandlung zu präsentieren, entfaltet Liessmann ein Panorama von Gedankenfragmenten, das die zersplitterte, von Brüchen und Diskontinuitäten geprägte Wirklichkeit der Gegenwart spiegelt. Diese essayistische Methode ermöglicht es dem Autor, sich seinem Gegenstand aus wechselnden Perspektiven zu nähern und ein breites Themenspektrum abzudecken, das von der Krise der Freiheit über die Krise der Moral bis hin zu Reflexionen über Humor und Mobilität reicht. Gerade diese fragmentarische Anlage ist es, die den Leser zur aktiven Partizipation einlädt, zum Knüpfen von Verbindungen, zum Aufspüren von Widersprüchen und letztlich zur Formulierung eigener Antworten. Diese Form erlaubt es dem Leser, an verschiedenen Stellen einzusteigen und die Lektüre als einen Dialog mit dem Autor zu begreifen, anstatt passiv eine fertige Lehre zu rezipieren.
Im Zentrum von Liessmanns Überlegungen steht eine begriffliche Schärfung, die in der gegenwärtigen, von inflationärer Krisenrhetorik geprägten Debatte eine befreiende Wirkung entfaltet. Mit Verweis auf die begriffsgeschichtlichen Forschungen Reinhart Kosellecks insistiert Liessmann darauf, die Krise als einen Moment der Entscheidung, als eine zeitlich begrenzte Unterbrechung des Alltags zu verstehen, nicht aber als dessen Fortsetzung mit anderen Mitteln. Die Diagnose eines permanenten Krisenzustands, so die bestechende Logik, hebt den Begriff der Krise selbst auf und führt zu einer gefährlichen Abstumpfung. Wer ständig in der Krise lebt, hat im strengen Sinne keine mehr. Diese semantische Präzisionsarbeit ist mehr als eine akademische Spitzfindigkeit; sie ist der Versuch, den Blick wieder für das zu öffnen, was auf dem Spiel steht, und die Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen, die in der resignativen Akzeptanz eines unentrinnbaren Verhängnisses zu versinken droht. Liessmanns Thesen dienen dazu, dem inflationären Gebrauch des Krisenbegriffs Einhalt zu gebieten und ihm seine analytische Schärfe zurückzugeben.
Das eigentliche Herzstück von Liessmanns „Philosophie der Krise“ bildet jedoch sein unerschütterliches und in der heutigen intellektuellen Landschaft beinahe schon anachronistisch anmutendes Plädoyer für das autonome Subjekt. In einer Zeit, in der kollektive Identitäten, moralische Gewissheiten und wohlmeinende Bevormundungen Konjunktur haben, hält der Autor unbeirrt an der aufklärerischen Vorstellung eines Menschen fest, der sich seines eigenen Verstandes ohne Leitung eines anderen bedient. Die zentrale Frage, die sich durch alle Essays zieht, lautet: Wird über uns entschieden, oder entscheiden wir selbst? Die Antwort, die Liessmann nahelegt, ist eine radikale Verteidigung der individuellen Urteilskraft. Er weigert sich, dem Leser vorzuschreiben, was er zu denken oder wie er zu wählen hat, um sich als „richtiger“ Demokrat zu erweisen. Stattdessen liefert er die Werkzeuge für eine kritische Analyse der Gegenwart und überlässt die Schlussfolgerungen dem mündigen Individuum. Dieses Festhalten an der Mündigkeit des Einzelnen ist ein Akt des Widerstands gegen die zunehmende Tendenz, den Bürger zu einem Objekt von Erziehungs- und Umerziehungsmaßnahmen zu degradieren.
Folgerichtig mündet dieses Beharren auf der Autonomie des Subjekts in eine vehemente Verteidigung der Meinungsfreiheit, die Liessmann als „grenzenlos“ verstanden wissen will. In einer Zeit, in der die Grenzen des Sagbaren immer enger gezogen werden und die sogenannte „Cancel Culture“ moralisch aufgeladene Debattenräume schafft, in denen abweichende Meinungen schnell sanktioniert werden, ist diese Position von unschätzbarem Wert. Der Autor scheut sich nicht, unpopuläre Standpunkte einzunehmen, sei es durch seine Warnung vor Alarmismus in der Klimadebatte, seine Kritik an der staatlichen Finanzierung zivilgesellschaftlicher Organisationen oder seine Ablehnung von Parteiverboten als undemokratisches Instrument. Er tut dies nicht aus einer Lust an der Provokation um ihrer selbst willen, sondern aus der tiefen Überzeugung, dass eine liberale Demokratie den offenen, auch schmerzhaften Diskurs nicht nur aushalten, sondern aktiv befördern muss. Liessmanns Position ist hierbei nicht die eines Relativisten, der alle Meinungen für gleich gültig hält, sondern die eines Liberalen, der darauf vertraut, dass sich im freien Wettstreit der Ideen die besseren Argumente durchsetzen werden.
Intellektuell schöpft Liessmann dabei aus einem reichen Fundus der Philosophiegeschichte. Insbesondere Friedrich Nietzsche erweist sich als intellektueller Pate. Nietzsches Perspektivismus, seine Kritik der Moral und seine scharfsinnige Analyse von Machtdynamiken durchdringen Liessmanns Denken. So verweist etwa die These, dass auch Opfer Machtpolitik betreiben können, auf eine nietzscheanische Sensibilität für die subtilen Formen des Willens zur Macht. Aber auch Spinoza wird als Referenzpunkt erkennbar, wenn es um die Befreiung von den Fesseln der passiven Affekte und die Stärkung der eigenen Handlungsmacht geht. Liessmann gelingt es dabei, diese philosophischen Referenzen nicht als bloße Zierde zu verwenden, sondern sie fruchtbar für die Analyse der Gegenwart zu machen und ihre ungebrochene Aktualität unter Beweis zu stellen. Er zeigt, wie die Denker der Vergangenheit uns helfen können, die Herausforderungen der Gegenwart besser zu verstehen und zu bewältigen.
Was Liessmanns Werk jedoch über eine bloße Anwendung philosophischer Klassiker auf die Gegenwart hinaushebt, ist sein einzigartiger Stil. Die rhetorische Brillanz des Autors, seine Fähigkeit, komplexe Sachverhalte präzise und elegant zu formulieren, und sein bildungsbürgerlich grundierten, aber niemals akademisch verknöcherter Ton machen aus der Lektüre ein zusätzliches Lesevergnügen. Liessmann bewegt sich souverän zwischen philosophischer Reflexion, kulturkritischer Polemik und feinsinniger Alltagsbeobachtung. Sein Schreiben ist eine Provokation, die jedoch nie in platte Polemik abgleitet, sondern stets zum Denken anregt. Diese stilistische Meisterschaft macht dieses Buch zu einem intellektuellen Hochgenuss, selbst dort, wo man dem Autor in der Sache vielleicht nicht folgen mag. Es ist ein Stil, der den Leser ernst nimmt und ihm zutraut, die Feinheiten und Ironien der Argumentation zu erfassen.
Konrad Paul Liessmann hat mit „Was nun?“ ein Buch von herausragender Qualität und brennender Aktualität vorgelegt. Es ist eine Streitschrift gegen die Bequemlichkeit des Denkens, gegen die vorschnellen Urteile und die moralische Selbstgewissheit, die weite Teile des öffentlichen Diskurses prägen. Das Werk liefert keine einfachen Lösungen oder gar ein Patentrezept zur Bewältigung der vielfältigen Krisen unserer Zeit. Sein Wert liegt vielmehr darin, dass es den Leser mit der ganzen Komplexität der Probleme konfrontiert und ihn zugleich mit dem Vertrauen in die eigene Urteilskraft ausstattet. Es ist eine Ermutigung, die titelgebende Frage nicht als Ausdruck der Verzweiflung zu verstehen, sondern als Ausgangspunkt für die Wiederaneignung der eigenen intellektuellen Souveränität. In diesem Sinne ist Liessmanns „Philosophie der Krise“ eine lebensrettende Lektüre in schwierigen Zeiten, ein Kompendium für den geistigen Selbstschutz und ein kraftvolles Manifest für die Freiheit des Denkens. Es ist ein Buch, das nicht nur gelesen, sondern auch diskutiert und kritisiert werden will, gerade darin liegt seine größte Stärke. Es ist ein Appell, die Krise nicht als Schicksal hinzunehmen, sondern als Chance zu begreifen, die eigenen Überzeugungen zu überprüfen und die Grundlagen unseres Zusammenlebens neu zu verhandeln. Ein solches Unterfangen ist in der Tat eine Zumutung, aber eine, die wir uns nicht ersparen dürfen, wenn wir die Zukunft unserer liberalen Gesellschaft gestalten wollen.
Meine Bewertung:
Veröffentlicht am 12: Oktober 2025