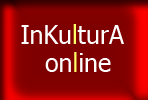Buchkritik -- Brie/Crome/Deppe/Wahl -- Weltordnung im Umbruch
 Die Welt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, der die Grundfesten der internationalen Ordnung erschüttert. Nach einem halben Jahrtausend, in dem erst europäische Mächte und später die Vereinigten Staaten die globalen Angelegenheiten dominierten, neigt sich diese Ära ihrem Ende zu. An ihre Stelle tritt keine neue, singuläre Hegemonialmacht. Stattdessen erleben wir die Entstehung einer multipolaren Weltordnung, in der eine Vielzahl von Staaten, insbesondere aus dem sogenannten Globalen Süden, an Einfluss gewinnt. Dieser historische Umbruch ist keine bloße Machtverschiebung, sondern ein fundamentaler Wandel, der eine beispiellose Komplexität mit sich bringt und uns vor völlig neue Fragen nach Stabilität, Konflikt und Kooperation stellt.
Die Welt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, der die Grundfesten der internationalen Ordnung erschüttert. Nach einem halben Jahrtausend, in dem erst europäische Mächte und später die Vereinigten Staaten die globalen Angelegenheiten dominierten, neigt sich diese Ära ihrem Ende zu. An ihre Stelle tritt keine neue, singuläre Hegemonialmacht. Stattdessen erleben wir die Entstehung einer multipolaren Weltordnung, in der eine Vielzahl von Staaten, insbesondere aus dem sogenannten Globalen Süden, an Einfluss gewinnt. Dieser historische Umbruch ist keine bloße Machtverschiebung, sondern ein fundamentaler Wandel, der eine beispiellose Komplexität mit sich bringt und uns vor völlig neue Fragen nach Stabilität, Konflikt und Kooperation stellt.
Der Abschied von der unipolaren Welt bedeutet zugleich das Ende einer relativen Vorhersehbarkeit. Die von westlichen Werten geprägten Institutionen verlieren ihre universelle Geltung. Der Aufstieg neuer globaler Akteure, allen voran der BRICS-Staaten, ist zutiefst politisch: Er zielt nicht nur auf einen größeren Anteil am globalen Wohlstand, sondern auch auf Mitsprache bei der Gestaltung der Regeln einer neuen Ordnung, getragen von eigenen historischen Erfahrungen und strategischen Interessen. Im Zentrum dieser neuartigen geopolitischen Konstellation steht das spannungsgeladene Verhältnis zwischen den USA, die ihre Vormachtstellung zu behaupten suchen, China als aufstrebender Supermacht und Russland als revisionistischer Kraft. Diese Konkurrenz erzeugt eine Atmosphäre des Misstrauens, die das Risiko von Konflikten erheblich steigert.
In dieser sich wandelnden Dynamik suchen auch etablierte Akteure wie die Europäische Union und Deutschland nach ihrer Rolle. Die von Bundeskanzler Scholz ausgerufene »Zeitenwende« markiert den Versuch Deutschlands, auf die veränderte Sicherheitslage in Europa, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine, zu reagieren und eine aktivere militärische sowie außenpolitische Rolle einzunehmen. Für die EU bedeutet dieser Umbruch die Herausforderung, ihre wirtschaftliche Stärke in strategischen Einfluss zu übersetzen und als geeinter geopolitischer Akteur aufzutreten, um in der globalen Mächtekonkurrenz nicht zwischen den Fronten zerrieben zu werden.
Die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten haben die Fragilität dieser neuen Ordnung offengelegt und zugleich tiefe Kontroversen ausgelöst, die weit in die Gesellschaft hineinreichen. Besonders in traditionell friedensbewegten Kreisen und der politischen Linken sind Debatten über die Legitimität militärischer Unterstützung und die Prinzipien einer pazifistischen Außenpolitik neu entbrannt. Diese Konflikte offenbaren ein tieferliegendes Ringen mit dem intellektuellen und emotionalen »Betriebssystem« von Bellizismus und Militarismus, das in Zeiten gefühlter Bedrohung an Akzeptanz gewinnt und überkommene Überzeugungen infrage stellt.
Angesichts dieser wachsenden Komplexität und der neuen Konfliktlinien müssen die Grundzüge einer Friedenspolitik für unsere Zeit neu entworfen werden. Eine solche Politik kann nicht länger ausschließlich auf die Ideale des Pazifismus oder die Routinen klassischer Diplomatie vertrauen. Sie muss die machtpolitischen Realitäten des 21. Jahrhunderts anerkennen und dennoch Wege zu Kooperation, Vertrauen und Deeskalation eröffnen. Die Pluralität der Perspektiven in einer multipolaren Welt eröffnet zwar Chancen für inklusivere Lösungsansätze globaler Probleme, doch ihre Verwirklichung setzt die Bereitschaft aller Akteure voraus, ein neues Gleichgewicht zu finden; eines, das nicht auf Dominanz, sondern auf gegenseitigem Respekt und geteilter Verantwortung beruht. Wir stehen am Beginn einer Epoche, deren Gestaltung, so die Autoren, eine an die Realitäten unserer Zeit angepasste Vision des friedlichen Zusammenlebens verlangt.
Das heißt: Die Durchsetzung vermeintlich universeller Demokratievorstellungen durch Konfrontation, Abschreckung oder gar militärische Gewalt darf kein Instrument zeitgemäßer Außenpolitik sein, weder in Deutschland, noch in Europa, noch anderswo. Eine der vordringlichen Aufgaben der Friedensbewegung wird daher darin bestehen, den Mechanismen der Feindbildproduktion, insbesondere gegenüber Russland, kritisch entgegenzutreten und der politischen Einseitigkeit eine Ethik des Dialogs entgegenzusetzen.
Ob das realistisch ist – oder ein Desiderat bleibt –, wird sich erst erweisen.
Meine Bewertung:
Veröffentlicht am 23. Oktober 2025