Buchkritik -- William Boyd -- Die Fotografin
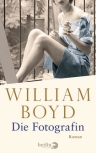 Wenn Sie die Fotografin Amory Clay nicht kennen, deren Biografie William Boyd in seinem neuen Roman erzählt, dann sind Sie in guter Gesellschaft. Diese Frau hat nämlich niemals existiert und ist ausschließlich ein Produkt der mitreißenden erzählerischen Phantasie des Autors. Boyd, dessen Spezialität es geradezu ist, fiktive Personen in den literarischen Rang der Realität zu heben, hat bereits mit der Figur des scheinbar in Vergessenheit geratenen amerikanischen Expressionisten Nat Tate für Wirbel in der Kunstszene gesorgt, denn sogar vermeintliche Koryphäen des Metiers gaben vor, Tate zu kennen. Peinlich, peinlich und ein irritierender Blick hinter die Kulissen sogenannter "Expertenkreise".
Wenn Sie die Fotografin Amory Clay nicht kennen, deren Biografie William Boyd in seinem neuen Roman erzählt, dann sind Sie in guter Gesellschaft. Diese Frau hat nämlich niemals existiert und ist ausschließlich ein Produkt der mitreißenden erzählerischen Phantasie des Autors. Boyd, dessen Spezialität es geradezu ist, fiktive Personen in den literarischen Rang der Realität zu heben, hat bereits mit der Figur des scheinbar in Vergessenheit geratenen amerikanischen Expressionisten Nat Tate für Wirbel in der Kunstszene gesorgt, denn sogar vermeintliche Koryphäen des Metiers gaben vor, Tate zu kennen. Peinlich, peinlich und ein irritierender Blick hinter die Kulissen sogenannter "Expertenkreise".
Nun also die 1908 geborene Engländerin Amory Clay, die bereits früh mit der Fotografie in Kontakt geriet und deren Berufswunsch seit dem ersten Klicken des Auslösers feststand. Fotografin wollte sie werden. Im England es frühen 20. Jahrhunderts wahrlich keine weibliche Domäne, verfolgt sie, Boyd sei gedankt, zielstrebig ihren Berufswunsch.
Der Leser nimmt am Leben einer Frau teil, die als Assistentin ihres Onkels als Gesellschaftsfotografin erste Erfahrungen sammeln konnte, dann mit einer Ausstellung über die dekadente Berliner Halbweltgesellschaft ins Fadenkreuz der britischen Justiz geriet und im Zuge dessen das Angebot eines amerikanischen Herausgebers annahm, in die USA zu reisen und dort eine neue berufliche Karriere zu beginnen.
Das alles lässt Boyd seine vermeintliche Fotografin aus der Ich-Perspektive erzählen, die ein Leben schildert, das reich an Höhen und Tiefen gewesen ist. Die inzwischen 70 Jahre alte Fotografin wohnt zurückgezogen auf einer kleinen britischen Insel, spricht täglich dem Whisky zu, schreibt ein Tagebuch und versinkt immer wieder vom Heute in ihre Vergangenheit.
Der Vater, traumatisiert durch seine Erlebnisse im Ersten Weltkrieg, wollte sich und seine Tochter umbringen und kam nach dem missglückten Versuch in eine Nervenheilanstalt, die ihn, damals als fortschrittlich geltend, mit einer Lobotomie zu einem gutmütigen, aber teilnahmslosem Menschen "heilte". Die Einser-Internatsschülerin schaffte daraufhin ihren Abschluss nur mit großer Mühe und das von ihr sowieso ungeliebte Studium der Geschichte in Oxford wurde hinfällig. Clay nahm es gelassen, schlug ihr Herz doch für die Fotografie.
"Die Fotografin" erzählt nicht nur ein fiktives Leben, sondern auch über ein großes Stück Zeitgeschichte. So fotografiert Clay sowohl im Zweiten Weltkrieg als auch im Vietnamkrieg. Die im Buch abgebildeten Schwarz-Weiß-Fotografien erzeugen dabei eine fast schmerzliche Authentizität, beweisen sie scheinbar doch geschickt die von Boyd gestrickte Imitation eines Lebens.
Je näher Amory Clay in ihren Erinnerung der eigenen Gegenwart kommt, desto emotionaler wird die Boyd`sche Diktion, gleitet jedoch niemals in seichte Sentimentalität ab. So ist sich Clay bewusst, dass ihre Kräfte schwinden und ihr geliebter, ebenfalls betagter Hund Flam, der letzte in ihrem Leben sein wird.
Ein Leben, das reich an überraschenden Wendungen gewesen ist und sich in keine, damals wie heute, üblichen Schablonen zwingen ließ. Amory Clay hat es verstanden, ein selbst bestimmtes Leben zu führen, ohne sich im Gestrüpp pseudofeministischer Attitüde zu verlieren. Es war, wie es gewesen ist und Clay lebte ein Leben, so wie sie es wollte.
"Die Fotografin" von William Boyd ist ein fiktives Stück Zeitgeschichte, dass wohl näher an der Wahrheit liegt, als so manche "authentische" Biografie.
Meine Bewertung:
Veröffentlicht am 14. Januar 2016
