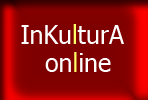Buchkritik -- Alessandro D'Avenia -- Der blinde Lehrer
 Die Geschichte eines blinden Lehrers, der mit zehn als „problematisch“ geltenden Schülern ein vom Lehrplan abweichendes Konzept verfolgt, um sie erfolgreich zum Abitur zu führen, könnte leicht ins Fahrwasser des typischen „Alles wird gut“-Kitschs geraten. Doch Alessandro D'Avenia schafft es knapp, diesem Klischee zu entkommen – zumindest auf den ersten Blick.
Die Geschichte eines blinden Lehrers, der mit zehn als „problematisch“ geltenden Schülern ein vom Lehrplan abweichendes Konzept verfolgt, um sie erfolgreich zum Abitur zu führen, könnte leicht ins Fahrwasser des typischen „Alles wird gut“-Kitschs geraten. Doch Alessandro D'Avenia schafft es knapp, diesem Klischee zu entkommen – zumindest auf den ersten Blick.
Omero, der Lehrer, beginnt seinen Unterricht mit einem bemerkenswerten und ungewöhnlichen Appell: Er fordert die Schüler auf, über ihre Freuden, Sorgen und Probleme zu sprechen. Anstelle einer nüchternen Namenskontrolle lässt er sich ihre Gesichter berühren, denn nur so, sagt er, könne er sie „sehen“. Diese Geste schafft es tatsächlich, Barrieren zu durchbrechen. Die Jugendlichen beginnen, sich zu öffnen und miteinander zu kommunizieren. Doch die Wirkung bleibt nicht auf das Klassenzimmer beschränkt – Omeros Ansatz verbreitet sich in der Schule, wo er jedoch auf massiven Widerstand stößt, vor allem seitens des Direktors und des Kollegiums.
So ambitioniert die Idee des „Chaos ordnen“ auch ist, wie Omero es selbst formuliert, hapert es leider an der Umsetzung. Der Text verliert durch den übertrieben rhetorischen Stil an Glaubwürdigkeit und belädt sich mit einer ermüdenden Aneinanderreihung von Zitaten, Klischees und banalen Aufzählungen, die die Geduld des Lesers auf eine harte Probe stellen.
Ein weiterer Schwachpunkt sind die Dialoge der 18-jährigen Schüler, die wenig authentisch wirken. Ihre Ausdrucksweise und Darstellung scheinen oft eher einem pädagogischen Wunschdenken als der realen Lebenswelt junger Menschen zu entspringen. Die resultierende Unglaubwürdigkeit wird noch verstärkt durch übertrieben moralische Ausführungen, die mehr belehren als berühren.
Trotz dieser Mängel ist D'Avenia ein gewisses Gespür für die Unsicherheiten und die Orientierungslosigkeit der Heranwachsenden nicht abzusprechen. Er zeichnet ein sensibles Bild einer Jugend, die sich von Schule, Gesellschaft und Politik verlassen fühlt und unterschiedlich auf diese Leere reagiert – sei es mit Hoffnungslosigkeit, Desillusion oder leiser Rebellion.
Doch an einer zentralen Stelle unterläuft dem Autor ein peinlicher Missgriff: Er bemüht die Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ aus dem Zweiten Weltkrieg als Metapher für seine Schülergruppe. Dieser Vergleich ist nicht nur deplatziert, sondern auch unangemessen pathetisch und überschätzt die Bedeutung der dargestellten Klassengemeinschaft maßlos. Ein weniger ambitionierter, realitätsnäherer Vergleich hätte nicht nur besser gepasst, sondern auch das Risiko vermieden, Leser durch diese Überhöhung vor den Kopf zu stoßen.
Insgesamt bleibt der Roman ein zwiespältiges Werk: Einerseits mit einem feinen Gespür für jugendliche Gefühlswelten, andererseits belastet durch stilistische Übertreibungen und fragwürdige Vergleiche, die die Authentizität und damit die Kraft der Erzählung deutlich schmälern.
Meine Bewertung:
Veröffentlicht am 10. Januar 2025