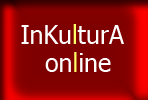Buchkritik -- Franz-Stefan Gady -- Die Rückkehr des Krieges
 Krieg war im kollektiven deutschen Bewusstsein lange Zeit eine ferne Realität, die in den Weiten fremder Kontinente stattfand und mit der man im eigenen Alltag wenig bis nichts zu tun hatte. Diese Vorstellung einer vermeintlichen Distanz ist jedoch durch den russischen Angriff auf die Ukraine empfindlich erschüttert worden. Was einst weit weg schien, ist nun durch politisches Unvermögen – oder, zynisch betrachtet, durch eine gezielte politische Inszenierung – beunruhigend nah gerückt.
Krieg war im kollektiven deutschen Bewusstsein lange Zeit eine ferne Realität, die in den Weiten fremder Kontinente stattfand und mit der man im eigenen Alltag wenig bis nichts zu tun hatte. Diese Vorstellung einer vermeintlichen Distanz ist jedoch durch den russischen Angriff auf die Ukraine empfindlich erschüttert worden. Was einst weit weg schien, ist nun durch politisches Unvermögen – oder, zynisch betrachtet, durch eine gezielte politische Inszenierung – beunruhigend nah gerückt.
Gegenwärtig erleben wir eine Renaissance der Falken. Ihre Forderungen nach verstärkter Kriegsbereitschaft werden immer unverhohlener geäußert. Zugleich sehen wirtschaftlich interessierte Kreise im möglichen Konflikt ein lukratives Geschäftsfeld. Das politisch-mediale Gefüge, teils desinformiert, teils wohl orchestriert von diesen Einflussnehmern, scheint bis auf wenige kritische Stimmen unisono dieselbe bedrohliche Melodie zu intonieren: die Warnung vor globalen Eskalationen.
Inmitten dieser kakophonen Rhetorik sticht das Werk von Franz-Stefan Gady, Militärberater und Senior Fellow am Institute for International Studies in London sowie Adjunct Senior Fellow am Center for New American Security in Washington DC, wohltuend hervor. Trotz seiner klar transatlantischen Perspektive gelingt es ihm, eine sachliche und faktenbasierte Analyse des Krieges und seiner tief verwurzelten politischen, wirtschaftlichen sowie zutiefst menschlichen Ursachen vorzulegen.
Seine zentrale These lautet: Sich auf einen Krieg vorzubereiten bedeutet, diesen mit hoher Wahrscheinlichkeit verhindern zu können. Diese seit dem Kalten Krieg bewährte Doktrin der Abschreckung bleibt auch im 21. Jahrhundert ein maßgeblicher Garant für den Frieden. Gady zeigt auf, dass die Wahrscheinlichkeit bewaffneter Konflikte in einer von zunehmenden geopolitischen Spannungen geprägten Welt wieder steigt – nicht zuletzt durch Fehlkalkulationen sowohl auf politischer als auch militärischer Ebene.
Ein besorgniserregendes Beispiel für solche Fehlannahmen ist die Hoffnung, dass der Einsatz künstlicher Intelligenz künftige Kriege kürzer und weniger blutig machen könnte. Diese Überlegung entpuppt sich als trügerisch, da sich alle potenziellen Konfliktparteien solcher Technologien bedienen würden, was eher zu einer Eskalation denn zu einer Deeskalation führen dürfte.
Angesichts dieser Entwicklungen ist es unerlässlich, dass Europa, allen voran Deutschland, seine sicherheitspolitischen Kapazitäten stärkt. Da die USA zunehmend durch innere politische Debatten und ihre strategische Neuausrichtung auf eine mögliche Konfrontation mit China gebunden sind, bleibt den Europäern keine andere Wahl, als eigenständig für ihre Sicherheit Sorge zu tragen.
Dennoch bleibt die zentrale Frage, ob sich die von geopolitischen Thinktanks und anderen Interessengruppen skizzierten Konfliktszenarien – wie ein möglicher Konflikt zwischen den USA und China oder zwischen Europa und Russland – nicht durch vorausschauende und diplomatische Politik im Vorfeld entschärfen ließen. Im Falle des russischen Einmarsches in die Ukraine bestand diese Möglichkeit durchaus, wurde jedoch vom sogenannten Wertewesten aus wohlbekannten Gründen nicht wahrgenommen.
Die eigentliche Gefahr für künftige Konflikte liegt letztlich in einem hegemonialen Politikverständnis, das in einer sich zunehmend multipolar entwickelnden Welt keinen Platz mehr hat. Wenn internationale Politik weiterhin durch Machtstreben und Einflussmaximierung geprägt bleibt, droht die Spirale der Aufrüstung und Eskalation sich unweigerlich fortzusetzen – mit potenziell verheerenden Konsequenzen für die gesamte Menschheit.
Meine Bewertung:
Veröffentlicht am 20. Dezember 2024