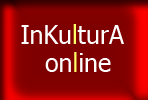Buchkritik -- Peter Stamm -- Auf ganz dünnem Eis
 Es gibt Schriftsteller, die ihre Welt aus der Fülle heraus gestalten, und solche, die sie aus der Leere destillieren. Peter Stamm gehört entschieden zur zweiten Kategorie. Seine Sprache kennt keine Ornamente, keine schützenden Schleier. Sie ist von jener Kargheit, die mehr verschweigt als sagt, und gerade darin ihr Geheimnis entfaltet.
Es gibt Schriftsteller, die ihre Welt aus der Fülle heraus gestalten, und solche, die sie aus der Leere destillieren. Peter Stamm gehört entschieden zur zweiten Kategorie. Seine Sprache kennt keine Ornamente, keine schützenden Schleier. Sie ist von jener Kargheit, die mehr verschweigt als sagt, und gerade darin ihr Geheimnis entfaltet.
In seinem Erzählband „Auf ganz dünnem Eis“ führt Stamm diese Poetik der Reduktion an einen Punkt, an dem sie selbst prekär zu werden beginnt, als würde auch seine Literatur das Eis unter den eigenen Füßen knacken hören.
Die zwölf Erzählungen des Bandes wirken zunächst unscheinbar: Menschen in Übergangszonen, Paare, die einander kaum noch berühren, Existenzen in sanftem Verfall. Kein Drama, kein Höhepunkt, keine Katharsis. Und doch zieht sich durch alle Texte eine feine, kaum hörbare Spannung, das Geräusch der Entfremdung, das Rauschen zwischen den Worten. Es ist, als habe Stamm die moderne Seele beim Verstummen belauscht.
Die Sprache dieser Erzählungen ist kühl, präzise, unsentimental. Stamm schreibt, als sei jedes Wort eine Bewegung auf dünnem Eis: zu viel Gewicht, und es bräche ein. Diese Disziplin, diese asketische Kontrolle über das Sagen, formt den Ton eines Autors, der der Leere traut. Wo andere Autoren noch erklären, lässt Stamm geschehen. Seine Figuren sprechen wenig, denken selten laut, sie „sind“ einfach, in einem Zustand der schwebenden Gegenwart, in dem Vergangenheit und Zukunft kaum noch unterscheiden lassen, was sie treibt.
Aber gerade in dieser Reduktion, in dieser Weigerung, das Leben auszuerzählen, zeigt sich eine metaphysische Genauigkeit. Denn was ist Entfremdung anderes als das Bewusstsein der Distanz zwischen uns und der Welt, zwischen Innen und Außen, Ich und Anderen? Stamm beschreibt diese Distanz nicht, er inszeniert sie.
Die Figuren wirken, als seien sie auf einer Bühne aus Glas: sichtbar, verletzlich, aber von sich selbst getrennt. Ihre Gesten sind tastend, ihre Worte vorsichtig, als sprächen sie nicht miteinander, sondern über eine unsichtbare Grenze hinweg. Das Eis, auf dem sie stehen, ist nicht nur Metapher, es ist das Material, aus dem ihr Dasein besteht.
Es ist ein Paradox, das Stamm meisterhaft beherrscht: Er schreibt über Nähe, um ihre Unmöglichkeit zu zeigen. Seine Paare sitzen einander gegenüber, als trennten sie Ozeane. Sie sprechen, doch die Worte sinken zwischen ihnen ein wie in Schnee. In dieser Stille entsteht eine eigentümliche Intimität, jene Kälte, die entsteht, wenn zwei Menschen sich zu lange betrachtet haben.
Man könnte sagen, diese Figuren haben das Sprechen verlernt, aber richtiger wäre: Sie haben begriffen, dass Sprache sie nicht mehr erreicht. Sie sind nicht stumm, sondern sprachmüde. Das, was sie sagen könnten, ist längst verbraucht in den unzähligen Varianten des Alltäglichen. So bleibt nur die Geste, der Blick, das Schweigen, Reste einer Kommunikation, die sich selbst nicht mehr glaubt.
Die Entfremdung, die hier spürbar wird, ist kein sozialer Missstand, sondern eine ontologische Müdigkeit. Es ist die Erfahrung, dass selbst die Innerlichkeit zu einer Kulisse geworden ist. Der Mensch, der bei Stamm auftritt, ist nicht Opfer äußerer Umstände, sondern Gefangener einer subtilen Transparenz: Er sieht sich, aber er spürt sich nicht. Das dünne Eis ist die Oberfläche des modernen Bewusstseins, glatt, klar, aber unbewohnbar.
Stamms Schweigen ist kein Mangel an Mitteilung, sondern eine Methode der Erkenntnis. Er schreibt, wie Wittgenstein über das Unsagbare sprach: „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.“ Nur dass Stamm dieses Schweigen nicht als Kapitulation versteht, sondern als eine Form des Hörens. Seine Texte sind Resonanzräume, in denen das Ungesagte stärker wirkt als das Gesagte.
Die Leere, die zwischen seinen Sätzen herrscht, ist nicht Abwesenheit, sondern Präsenz einer anderen Art: die Ahnung dessen, was nicht mehr formulierbar ist. Der Leser spürt diese Spannung, diese fragile Energie der Unterlassung, als müsse er selbst die fehlenden Worte finden, um das Unsichtbare zu verstehen. So wird Lesen bei Stamm zu einem Akt der Teilhabe: Der Leser wird Komplize im Versuch, Bedeutung zu retten, wo Sprache bereits zerfallen ist.
In dieser Haltung liegt ein moralischer Kern. Stamm verweigert das falsche Pathos, die bequeme Einfühlung, das sentimentale Versprechen von Sinn. Seine Figuren haben keinen Trost, keinen „Bogen“, keine Lösung, weil das Leben, das er beschreibt, keine Dramaturgie kennt. In einer Zeit, in der Literatur oft zum emotionalen Selbstservice verkommt, besteht er auf der Würde der Leerstelle. Das ist nicht Kälte, sondern Konsequenz: Wer die Wahrheit der Entfremdung ernst nimmt, darf sie nicht durch Sprache zudecken.
Damit steht Stamm in einer Tradition, die von Camus’ „Fremdem“ bis zu Beckett reicht. Doch während Camus den Absurden noch einen Akt der Rebellion gestattet, verweigert Stamm selbst diesen. Seine Figuren revoltieren nicht. Sie gleiten. Ihre Bewegung ist das Schweigen. Ihr Widerstand besteht im Überleben. Insofern ist seine Literatur weniger existentialistisch als postmetaphysisch: Sie beschreibt den Menschen, nachdem alle Sinnsysteme kollabiert sind, und entdeckt in dieser Sinnlosigkeit eine neue Form der Wahrhaftigkeit.
Der Titel „Auf ganz dünnem Eis“ fasst diese Poetik exemplarisch zusammen. Das Eis steht für die fragile Schicht zwischen Innen und Außen, zwischen Ich und Welt, zwischen Bedeutung und Nichts. Es trägt uns, solange wir uns vorsichtig bewegen, aber niemand weiß, wie lange noch.
Diese Unsicherheit ist die Signatur unserer Epoche: das Gefühl, dass alles noch hält, aber nichts mehr sicher ist. Die Figuren bei Stamm sind Kinder dieser Zeit. Sie leben in Wohnungen, Beziehungen, Berufen, doch das Fundament ihres Daseins ist bereits rissig. Sie wissen es, und sie tun nichts. Nicht aus Trägheit, sondern aus einer seltsamen Klarheit: dass jedes Handeln nur eine andere Form des Schweigens wäre.
Vielleicht liegt in dieser Haltung eine stille Revolte, nicht gegen die Gesellschaft, sondern gegen das Geräusch der Welt. Stamm schreibt gegen das Zuviel, gegen das Reden ohne Not, gegen den Exhibitionismus der Empfindung. Seine Literatur ist kein Rückzug, sondern eine Reinigung. Sie entzieht sich der Logik des Spektakels und findet Schönheit im Verschwinden.
Damit ist „Auf ganz dünnem Eis“ ein Buch, das mehr denkt, als es erzählt. Es ist kein Erzählband im herkömmlichen Sinn, sondern eine poetische Meditation über das, was von uns bleibt, wenn wir alles gesagt haben. Seine Kälte ist von jener Art, die erst beim zweiten Hinsehen wärmt: Sie schützt das, was nicht verhandelbar ist, die Stille, die Erinnerung, das ungesagte Ich.
Peter Stamm hat mit diesem Buch nicht nur eine Sammlung von Geschichten geschrieben, sondern eine geometrische Skizze des modernen Bewusstseins. Jedes Wort ist eine Linie, jede Pause eine Fläche, jeder Satz ein Riss im Eis. Und irgendwo darunter, kaum hörbar, schlägt das Wasser weiter.
Ein stilles, präzises, schmerzhaft schönes Buch über das Menschsein in seiner transparentesten Form: klar, zerbrechlich, allein.
Meine Bewertung:
Veröffentlicht am 2. Novembeer 2025