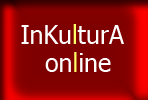Buchkritik -- Ulrike Guérot -- ZeitenWenden
 In ihrem jüngsten Buch „ZeitenWenden‟ entwirft Ulrike Guérot ein Panorama der politischen und gesellschaftlichen Erschütterungen, das sich weniger durch lineare Argumentation als durch eine flirrende, essayistische Verdichtung auszeichnet. Was die Politologin und streitbare Intellektuelle hier vorlegt, ist ein alarmierender Seismograf unserer Zeit, eine Reflexion über das Abgleiten der westlichen Demokratien in einen Zustand postliberaler Selbstvergessenheit.
In ihrem jüngsten Buch „ZeitenWenden‟ entwirft Ulrike Guérot ein Panorama der politischen und gesellschaftlichen Erschütterungen, das sich weniger durch lineare Argumentation als durch eine flirrende, essayistische Verdichtung auszeichnet. Was die Politologin und streitbare Intellektuelle hier vorlegt, ist ein alarmierender Seismograf unserer Zeit, eine Reflexion über das Abgleiten der westlichen Demokratien in einen Zustand postliberaler Selbstvergessenheit.
„Zeitenwende“, dieser Begriff, von Olaf Scholz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine in den politischen Diskurs eingespeist, fungiert bei Guérot nicht bloß als Chiffre geopolitischer Umbrüche. Vielmehr begreift sie ihn als Diagnose eines zivilisatorischen Kipppunktes: Der Liberalismus, lange als unhinterfragtes Fundament der westlichen Moderne betrachtet, scheint auszubleichen. An seine Stelle treten Sicherheitsdenken, Identitätspolitik und eine Erosion der öffentlichen Debattenkultur.
Guérot zeichnet ein Bild einer Gesellschaft, die sich zunehmend an der Oberfläche verliert. Wo einst Argument und Diskurs dominierten, regieren heute Affekt und Format. Die Grenzen zwischen Fakt und Fiktion verschwimmen, ein Symptom, das sie treffend als „Verlust der Wirklichkeit“ umschreibt. Medien, einst Bollwerk der Aufklärung, geraten unter Verdacht, Meinungsbildung nicht mehr zu ermöglichen, sondern zu lenken. In dieser Gemengelage werde die liberale Demokratie, so Guérot, nicht reformiert, sondern umfunktioniert.
Ein zentrales Thema widmet sich dem Begriff der Stasis, eine spezifische historische und politische Konstellation, die ursprünglich aus dem antiken Griechenland stammt. Dort bezeichnete „Stasis“ (στάσις) einen innergesellschaftlichen Konflikt, insbesondere bürgerkriegsartige Auseinandersetzungen innerhalb der Polis, oft begleitet von Gewaltexzessen, sozialen Zerwürfnissen und einem Zusammenbruch der politischen Ordnung.
Girod verwendet diesen Begriff nicht bloß historisch, sondern überträgt ihn auf die gegenwärtige gesellschaftspolitische Lage. Dabei dient „Stasis‟ als Diagnosebegriff für eine Zeit tiefgreifender Spannungen, Polarisierungen und Orientierungslosigkeit, in der hergebrachte Ordnungen zerfallen, neue Ordnungen aber noch nicht stabil etabliert sind. Es handelt sich also um eine Übergangssituation mit blockierten Kräften, sozialen Spaltungen und systemischer Destabilisierung.
Girods Analyse lässt sich als Versuch verstehen, die gegenwärtigen „ZeitenWenden‟, etwa ausgelöst durch Klimakrise, geopolitische Verschiebungen, Digitalisierung und den Verlust kultureller Selbstverständlichkeiten, als Phasen der Stasis zu deuten: Es fehlt nicht an Bewegung, wohl aber an Richtung und verbindlicher Ordnung. Stasis ist hier sowohl Ausdruck eines tiefgreifenden Umbruchs als auch Warnsignal für potenziell destruktive gesellschaftliche Dynamiken.
Ein weiteres zentrales Motiv des Buches ist die Auflösung des Politischen in eine übermoralische Überwachungskultur. Guérot beklagt, dass Diskussionen nicht mehr entlang von Positionen, sondern entlang von Gesinnungen geführt würden. Der Meinungskorridor werde enger, der Preis für Abweichung höher. In einer Zeit, in der das Private bis ins letzte Detail politisiert werde, drohe die demokratische Öffentlichkeit zu einem Tribunal zu verkommen.
Insbesondere europäische Staaten sieht die Autorin dabei auf dem Holzweg: Anstatt europäische Integration als zivilisatorisches Friedensprojekt weiterzudenken, verstricke man sich in Nationalismen, Wirtschaftskriege und politische Symbolpolitik. Guérot kritisiert scharf die kriegerische Rhetorik in der Ukrainepolitik und sieht darin ein Symptom eines allgemeinen Entzugs von Friedensfähigkeit, eine These, die nicht ohne Provokation bleibt.
Wie bereits in früheren Werken, allen voran „Warum Europa eine Republik werden muss‟, wirbt Guérot vehement für ein politisches Europa, das seine Idee verwirklicht: souverän, föderal, gerecht. Doch „ZeitenWenden‟ ist weniger ein utopischer Entwurf als eine düstere Bestandsaufnahme. Es dominieren Desillusionierung, Erschöpfung, die Ahnung eines politischen Endspiels.
Ihre scharfe Unterscheidung zwischen Eliten und Volk mag dabei mitunter an populistische Narrative erinnern. Doch anders als Demagogen, die Ressentiments bedienen, versucht Guérot, eine systemische Entfremdung zu erfassen: Die Demokratie sei nicht durch zu viel Partizipation gefährdet, sondern durch ihre schleichende Technokratisierung und Entleerung. In ihrer Kritik an Expertokratie und Diskursverengung knüpft sie an Autoren wie Ivan Krastev oder Wolfgang Streeck an, ohne deren soziologische Tiefe immer zu erreichen.
Stilistisch beeindruckt „ZeitenWenden‟ durch eine elegante, fast flaneurhafte Essayistik. Guérot schreibt mit Furor, aber ohne Pathos; mit analytischer Schärfe, aber ohne trockene Abstraktion. Ihre Beobachtungen sind oft schmerzlich präzise, ihre Sprachbilder treffend und bisweilen poetisch. Kleines Manko: Das Buch leidet unter seiner fragmentarischen Struktur: Es sind lose Denkstücke, keine aufeinander aufbauenden Argumentationsschritte. Nicht immer wird klar, welche Lösungsvorschläge sich aus der Analyse ergeben.
Guérots Stärke ist der Weckruf, nicht die Ausarbeitung. Wer politische Konzepte, gar institutionelle Modelle erwartet, wird enttäuscht. Vielmehr inszeniert sie die Gegenwart als existentielle Herausforderung, die eine geistige Erneuerung verlangt, bevor strukturelle Veränderungen überhaupt denkbar sind.
Ulrike Guérot hat mit „ZeitenWenden‟ ein streitbares, unbequemes Buch vorgelegt. Es ist mehr Pamphlet als Programm, mehr Resonanzraum als Rezept. Doch in einer Zeit, in der viele den politischen Verfall zwar spüren, aber nicht benennen können, gelingt ihr ein seltenes Kunststück: Sie gibt der Sprachlosigkeit eine Stimme, und dem Verstummen einen Widerhall.
Das Buch ist kein Werk, das man konsumiert. Es ist ein Buch, das man befragt, das provoziert, herausfordert, manchmal auch verärgert. Aber genau das ist seine Stärke. Denn wo keine Widersprüche mehr erlaubt sind, endet die Demokratie.
Mein Fazit: Lesen und weitergeben.
Meine Bewertung:
Veröffentlicht am 22. Juni 2025